Jahreszeiten – Lebenszeiten
- Bruno Rauch

- 22. Okt. 2025
- 5 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 24. Okt. 2025

© Bilder: Bruno Rauch
Es ist eine kluge Idee, zum Start in eine neue Chorsaison «Die Jahreszeiten» von Joseph Haydn aufs Programm zu setzen! Nicht nur, weil eine Wiederbegegnung mit diesem «jugendfrischen» Werk jedes Mal ein geistreiches Vergnügen ist, sondern auch, weil es einem Vokalensemble (natürlich ebenso den beteiligten drei Solisten und dem Orchester!) die Möglichkeit bietet, sich gleich in mehreren, unterschiedlichen Genres zu profilieren. Und die formidable Zürcher Sing-Akademie unter ihrem Leiter Florian Helgath kann so ausgiebig zeigen, was sie an Gestaltungsmöglichkeiten alles draufhat, um es mal etwas salopp zu formulieren.

Tatsächlich vereinigt Haydns Opus Hob. XXI:3 wie kaum ein anderes Chorwerk auf bewundernswert kompakte Weise ein großes Spektrum an Gattungen und Stilen; es bietet damit sozusagen eine klangliche Enzyklopädie der aufklärerischen Ausdrucksmittel zwischen barocker Tradition und frühromantischer Tonsprache: Da stehen hymnische Jubelchöre und innige, fast liturgische Bittgesänge neben schlichten Chorliedern im Volkston, choralartige Andachtsmomente neben opernhaftem Gestus, Doppelchor und kunstvolle Fugentechnik neben homophoner Melodik. Selbst eine «besoffene Fuge» (nach Haydns eigenen Worten) darf nicht fehlen. Mit anderen Worten: Da spannt sich nicht nur thematisch, sondern auch musikalisch ein Bogen von der Ackerfurche übers dörfliche Erntedankfest bis zu den sich öffnenden Himmelspforten…
Wir haben eingangs von einem «jugendfrischen» Werk gesprochen. Dies ist ein weiterer erstaunlicher Aspekt dieses ungewöhnlichen Oratoriums. Als er 1799 mit der Komposition der «Jahreszeiten» begann, war Haydn 67 Jahre alt. Nach den äußerst erfolgreichen Aufführungen der «Schöpfung», 1798 privat und anschließend quer durch Europa, hatte ihn Baron Gottfried van Swieten, der Librettist jenes Werks, genötigt, mit einem weiteren Oratorium an dessen Erfolg anzuknüpfen, was mit der wiederum erfolgreichen Uraufführung der «Jahreszeiten» 1801 im Wiener Palais Schwarzenberg auch gelang. Doch die zweijährige Arbeit hatte an Haydns Kräften gezehrt; er hätte sie nie schreiben sollen, er habe sich dabei übernommen, notierte er wenig später. «Hin ist alle meine Kraft, alt und schwach bin ich», ließ er auf seine Visitenkarte drucken. Von alledem ist in den «Jahreszeiten» jedoch nichts zu spüren. Auch nichts von den peniblen Auseinandersetzungen mit van Swieten, der sich zunehmend in die Komposition einmischte. Wie schon für die «Schöpfung» hatte dieser hochgebildete, literarisch wie kompositorisch ambitionierte, aber offenbar recht eigensinnige Diplomat in habsburgischen Diensten wiederum auf ein englisches Versepos zurückgegriffen: auf «The Seasons» des Schotten James Thomson (1700-1748), von dem übrigens auch das berühmte «Rule, Britannia!» stammt. Dem umtriebigen Baron muss man allerdings zugute halten, dass er Mozart mit den Kompositionen von Bach und Händel bekannt gemacht hatte – Mozarts Bearbeitung des «Messias» geht auf seine Anregung zurück – und dass er die Aufführung von dessen Requiem als Benefizkonzert für die Witwe Constanze und die beiden Söhne ermöglichte.

Gottfried van Swieten (1733–1803) Joseph Haydn (1732–1809) Florian Helgath
@ Bilder wikimedia commons © Christian Palm
Für seine Fassung reduzierte van Swieten nicht nur die ursprünglich gut 4300 Verse von Thomsons Vorlage, in deren Zentrum der Mensch in seinem Verhältnis zur Natur steht, einer alles bestimmenden Natur, zwar von Gott geschaffen, jetzt aber allein der menschlichen Umsicht ohne weiteren göttlichen Eingriff überlassen. Darüber hinaus unterfüttert der Autor die deistische Haltung mit bürgerlichen Tugenden wie Fleiss und Moral. Dramaturgisch geschickt verquickte er das «Zurück-zur-Natur» mit einer aufklärerischen Objektivität, indem die drei Protagonisten, der Pächter Simon (Bar.), seine Tochter Hanne (S) und ein junger Bauer Lukas (T), nicht primär als Handelnde, sondern als Betrachtende im Einklang mit dieser klassisch geprägten, vernunftvollen Ordnung dargestellt sind. (Ausgenommen davon ist das Liebesduett Hanne-Lukas.)

Jahreszeiten – Lebenszeiten
Haydn folgt diesem rationalen Anspruch, lässt aber immer wieder eine unüberhörbare Subjektivität einfließen, wenn er den Naturerscheinungen – Gewitter, Nebel, Kälte usw. – emotionalen Gehalt zubilligt, ohne jedoch in eine romantisch-empfindsame Naturschwärmerei zu verfallen. Die Naturschilderungen – summende Bienen, quakende Frösche, aber auch der flötende Ackersmann, die Weinlese, die Parforcejagd oder das Spinnen am häuslichen Rocken, sie alle sind in das große zyklische Ganze eingebettet, das in einer gewaltigen doppelchörigen Schluss-Apotheose kulminiert, die das Landleben in einen kosmischen Zusammenhang stellt und daraus eine philosophische Reflexion über die menschliche Existenz herleitet, über das Werden und Vergehen und die Möglichkeit eines jenseitigen Lebens… Der Jahreslauf mit seinen bäuerlichen Tätigkeiten, die Haydn von frühester Jugend an vertraut waren, erfährt somit eine transzendentale Deutung. Gleichzeitig spiegelt sich darin auch die persönliche Situation des alternden Komponisten. Darüber hinaus markieren die «Jahreszeiten» geistesgeschichtlich einen Wendepunkt vom 18. zum 19. Jahrhundert, vom klassischen Ideal des Objektivismus zur romantischen subjektiven Wahrnehmung von Welt und Natur.

Die Zürcher-Sing-Akademie hat sich zu einem der führenden professionellen Chöre im deutschsprachigen Raum entwickelt. Dank Wandlungsfähigkeit, geschärfter Ausdruckskraft, gepaart mit subtiler Differenzierung und untadeliger Intonation, wird das Ensemble – acht Sängerinnen und Sänger pro Stimme – dem vielschichtigen Werk in idealer Weise gerecht, stilsicher und energievoll. Dirigent Florian Helgath hat ganze Arbeit geleistet: Die einzelnen Stimmen sind profiliert und transparent herausgearbeitet, fügen sich aber gleichzeitig zu einem bewundernswert homogenen Gesamtklang: sozusagen sinfonischer Anspruch mit kammermusikalischem Ansatz. Die Chorsoprane klingen selbst in Spitzentönen rund und warm, die Bässe bleiben auch in tiefen Lagen kernig, ohne grummelige Unschärfe. Der erwähnte Lobgesang auf den Wein über dem bäurischen Bourdon-Bass wird zum mitreißenden «Lustgeschrei» (zit.), das einen kaum stillsitzen lässt, die Gewitterszene mit ihrem bedrohlichen Crescendo zum eindrucksvollen Tongemälde, das Spinnerinnenlied zum leicht ironisch gefärbten Genrebild. Die chorischen Einwürfe in Hannes Lied vom übergriffigen Edelmann verweisen geradewegs auf eine witzige Opernszene, die Webers Spottszene aus dem «Freischütz» vorwegnimmt. Stimmenglanz und emotionale Intensität machen den Schlussgesang im Wechsel mit den Solisten zum finalen Höhepunkt.

Werner Güra, Tenor (Lukas) Elsa Benoit, Sopran (Hanne) Manuel Walser, Bariton (Simon) (Bild: © Marie Capesius) (Bild: © James Ballerini) (Bild: © Thomas Walser)
Brillant ist auch das Solistentrio. Manuel Walsers voller, ausdrucksstarker Bariton passt ausgezeichnet zur Figur des in sich ruhenden Simon, der die Ackerfurchen – und Notenlinien – in souveräner Gelassenheit abschreitet; sein «Ackersmann» besticht durch genuine Natürlichkeit im neckischen Dialog mit dem Piccolo. Die erzählenden Passagen gestaltet er mit ungekünstelter, frei strömender und, wo erforderlich, dramatisch zugespitzter Klangrede.
Werner Güra gibt einen jugendlichen Bauer mit tenoralem Schmelz und unangestrengter Höhe. Packend, wie er die Schilderung des in Schnee und Eis irrenden Wanderers mit fahler Stimme schildert, dagegen im Dialog mit seinem «Hannchen» –wiederum eine intime, bezaubernde kleine Opernszene – sein Schmachten mit kantablem Charme und Zartheit vorträgt. Das allerdings dürfte dem Sänger nicht allzu schwergefallen sein: Lisa Benoit ist wirklich eine bezaubernde Hanne. Mit lichtem Sopran und ausgefeilter, nuancierter Farbgebung gestaltet sie die Partie der jungen Bäuerin. Sie weiß der kindlichen Freude, dem naiven Staunen über das Geschehen auf Flur und Feld, Haus und Hof ebenso überzeugenden Ausdruck zu verleihen wie der jungmädchenhaften Koketterie. Besonders schön zeigt sich das in ihrer bereits erwähnten Ballade, mit der sie die in der warmen Stube versammelten Landleute unterhält. Sie berichtet von einem pfiffigen Bauernkind, das einem draufgängerischen Junker eine gehörige Abfuhr erteilt und macht daraus ein theatralisches Kabinettstück von delikatem Schalk.


An diesem faszinierenden Bilderbogen an Emotionen, Stimmungen und Szenen, oft auch mit einer Prise unterschwelligem Humor, hat das glänzend disponierte Finnish Baroque Orchestra (FIBO) einen wesentlichen Anteil. Das historisch informierte Ensemble, bereits 1989 gegründet, hat zwar seine Wurzeln in der Alten Musik, hat aber seinen Horizont vom Mittelalter über die Frühklassik und Klassik bis zur zeitgenössischen, vorab finnischen, Musik erweitert. Der hellwache, relativ schlankbesetzte, aber umso spielfreudigere Klangkörper aus dem hohen Norden ist somit ein idealer Partner für den ebenfalls durch Vielseitigkeit glänzenden Chor. Jedenfalls ist die Balance zwischen Chor und Orchester ausgezeichnet. Musikantische Akzente in echt haydn’schem Sinne ins farbige Klangbild setzen die Naturhörner und schmetternden Trompeten. Auch die fantasievolle Anna-Maaria am Fortepiano sowie die Perkussionistin Tuija-Maija Numinen mit knackig-pointiertem Schlag dürfen nicht unerwähnt bleiben; hübsches Detail: der Part des Triangels und des Tambourins im ausgelassenen Saufgelage wird von zwei Chorsängern übernommen.
«Ei, ei, das klingt recht fein!» kommentiert der Chor Hannchens spöttische Erzählung. Eine Aussage, die für die ganze Aufführung gilt!
Finale: Terzett mit Doppelchor – «Dann bricht der große Morgen an» (© Bruno Rauch)

P.S. Nächstes Konzert der Zürcher Sing-Akademie: Beethovens «Missa solemnis»
• 28. Oktober 2025 – Casino Bern, 19:30 Uhr
• 29. Oktober 2025 – Tonhalle Zürich, 19:30 Uhr
tickets@sing-akademie.ch Ticketphone: 077 442 77 09
21.10. 2025
Vielleicht interessiert sie auch dieser Beitrag.
Weitere Beiträge finden Sie hier.
Abonnieren Sie die «rauchszeichen» – gratis und franko und ohne jede Verpflichtung!
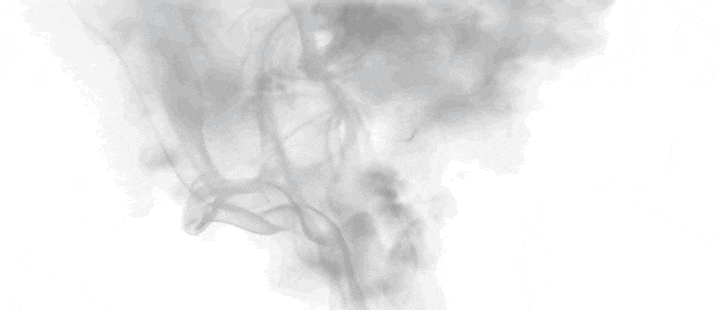


Wenn man diese Kritik liest, ist einem klar, dass man ein ganz tolles Konzert verpasst hat! Tatsächlich habe ich mir die Jahreszeiten vor zwei Tagen auf Mezzo TV (mit Il Giardino Armonico, unter der Leitung von Giovanni Antonini) angehört und war hin und weg. Ich liebe ja auch seine «Schöpfung» über alles.
R. G.