Amor: 12 points!
- Bruno Rauch

- 8. Juni 2025
- 8 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 12. Juni 2025
Sie kennen das berühmte – und leicht anstößige – Bild von Michelangelo Merisi, besser bekannt als Caravaggio? Gemalt hat er es in den Jahren 1602/03 in Rom als Auftragsarbeit des Marchese Vincenzo Giustiniani, eines vielseitig gebildeten Kunstsammlers. Sogar der kecke Bube, der dem heißblütigen Maler – unter anderem? – als Modell diente, ist bekannt: Ein gewisser Francesco Boneri, damals etwa 12jährig und später selbst ein ganz passabler Maler.

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) – Staatliche Galerien, Berlin – © wikimedia
Doch jetzt, auf der Leinwand und für uns Betrachter, mimt Cecco, wie er genannt wurde, den Liebesgott Amor, charakterisiert durch zwei mächtige Adlerschwingen. In unbekümmerter Heiterkeit, fast ein wenig spöttisch-dreist, vielleicht sogar etwas schadenfroh, blickt er uns direkt an. Auffallend ist seine eigenartig unstabile Haltung: Der rechte Fuß sucht Halt auf dem Boden, während das linke Bein beim Knie zurückgebogen ist, als würde der Lümmel sich soeben von einer Lagerstatt erheben, was das weiße Laken andeuten könnte. Bei genauem Hinsehen entdeckt man jedoch hinter dem Standbein einen gestirnten Globus; vielleicht rührt die eigenartige Haltung auch daher: Da scheint einer auf einer Kugel zu balancieren wie auf einem Sitzball. Dazu stützt er sich mit dem linken, nicht sichtbaren Arm rücklings ab, derweil die rechte Faust zwei gefiederte Pfeile umklammert, einen roten Liebespfeil und einen schwarzen, der Liebeschmerz, Liebestod gar, verursacht. Auf dem Boden verstreut, teilweise im Chiaroscuro nur vage zu erkennen, die Insignien aus Kunst, Geistesleben, Politik... Ein aufgeschlagenes Buch mit Federkiel des Literaten; Theorbe, Geige und ein Notenblatt des Musikers; Zirkel und Winkelmaß des Architekten; Brustpanzer eines Kriegers; dazu Lorbeerkranz, stilisierte Krone und Purpur der Siegreichen und Mächtigen. Und schließlich der erwähnte Himmelsglobus des Astronomen… Kein akkurat arrangiertes Stillleben, sondern irdische Güter und Symbole in ungeordneter Fülle, achtlos liegengelassen, nutzlos geworden. Gegenüber der Macht der Liebe haben sie ihre Bedeutung verloren...

Das Bild heißt denn auch «Amor vincitore», der siegreiche Amor. Das ikonografische Motiv des Kolossalgemäldes illustriert eines der berühmtesten lateinischen Zitate. Einleuchtend, dass es den mittelalterlichen Minnesängern zum Wahlspruch wurde. Man findet es bei Dante und Virginia Woolf ebenso wie bei Umberto Eco oder Patrick Süskind (und es würde mich nicht wundern, wenn auch Frau Pilcher es als Romantitel verwendet hätte). Es prangt auf T-Shirts und offenbar auch auf bloßer Haut – als beliebtes Tattoo-Sujet. Es beflügelte unter anderen Komponisten wie Orlando di Lasso zu einer 5-stimmigen Motette (16. Jh.), inspirierte die englische Rock Band «Pure Reason Revolution» zum Titelsong «Victorious Cupid» eines Albums (2009), fand sogar seinen Niederschlag in der finalen Staffel der Netflix-Serie «Sense8», einer Art Psychogruppenchat – globale Telepathie, kollektive Erleuchtung, exklusive Nervenzusammenbrüche und ein gerüttelt Maß an Liebe ... und Sex (2018).
Wohl und weh dem, den’s trifft
Und so lautet diese vielfach zit- und malträt-ierte Sentenz: «Omnia vincit Amor et nos cedamus Amori» (Die Liebe besiegt alles, lasst auch uns der Liebe nachgeben). Sie stammt aus Vergils 10. (und letzter) Ecloge, einem Hirtengedicht, entstanden im 1. Jh. vor Chr. Der Dichter widmet es seinem realen Freund Gallus, den er in fiktiver Gestalt eines liebeswunden Schäfers in einer bukolischen Landschaft auftreten lässt. Im Einklang mit der ihn umgebenden Natur klagt dieser den Fluren und Hainen, dem Wind und den Wellen sein Leid als verlassener Liebhaber der ungetreuen Lycoris, die sich mit einem anderen über die Berge davongemacht hat. Doch trotz arkadischem Szenario wird ihm schmerzlich bewusst, wie ausweglos die Situation ist: Amors Pfeil entgeht man nicht!
Da sind bereits sämtliche Ingredienzien vorhanden, die sich auch in Johann Christian Bachs szenischer Kantate «Amor vincitore» wiederfinden werden.

Jörg Halubek – Dirigent, Cembalist, Organist Johann Christian Bach, Komponist (1735–1782)
© Foto – Marco Borggreve Gemälde: Thomas Gainsboroughm 1776
Johann Christian war J. S. Bachs jüngster Sohn und das elfte von dreizehn Kindern aus dessen zweiter Ehe mit Anna Magdalena. Seine musikalische Ausbildung erhielt er erst beim Vater, dann bei seinem Halbbruder Carl Philipp Emanuel in Berlin, später in Italien beim berühmten Padre Martini. Dort konvertierte er – trotz heftiger Missbilligung des Bruders – nicht nur zum Katholizismus, um als Organist am Mailänder Dom wirken zu können, sondern «infizierte» sich auch prompt mit dem Opernvirus; von seinen zehn überlieferten Opern stammt die Hälfte, ganz dem Zeitgeist entsprechend, von Metastasio. Ab 1762 lebte er in London als persönlicher Musiklehrer der Gattin von Georg III. Neben diversen Opernerfolgen am King’s Theatre tat er sich zusammen mit einem befreundeten Gambisten auch als Konzertunternehmer hervor. Musikgeschichtlich bedeutsam ist jene Begegnung mit dem 9-jährigen Mozart, der auf seiner Grand Tour mit Vater Leopold auch in London Station machte und sich gemäß Zeitzeugen im vierhändigen Klavierspiel freundschaftlich mit dem «Londoner-Bach», rund zwanzig Jahre älter als der Knirps aus Salzburg, maß. Noch Jahre später – zum Beispiel anlässlich einer Wiederbegegnung in Paris – meldet Mozart die gegenseitige Freude darüber in bewegten Worten nach Hause: « ...seine freüde und meine freüde können sie sich leicht vorstellen – ich liebe ihn [...] von ganzem herzen.» (27.8.1778)

François Boucher (1739–1770): Idealisiertes Arkadien – so könnte man sich die Szenerie zur
«Azione teatrale» von J. Chr. Bach vorstellen (Musée du Louvre, Paris – © wikimedia)
1774 heiratete Bach die italienische Opernsängerin Emilia Grassi. Aus dieser Zeit stammt auch die Kantate «Amor vincitore»; wohl wahrscheinlich, dass sie selbst die Dalisa, die weibliche der beiden Sopranpartien, gesungen hat. Jedenfalls war der Erfolg so beachtlich, dass das Werk im September selbigen Jahres als Azione teatrale in Schwetzingen noch zweimal aufgeführt wurde. Das dortige Hoftheater war eines der elegantesten in Europa und der pfälzische Kurfürst Carl Theodor ein äußerst kunstliebender Regent. Wer die Partie des Hirten Alcidoro übernahm, ist nicht überliefert – in London wimmelte es damals von fulminanten Kastraten. Ebenso tappen wir bezüglich Textautor im Dunkeln. Gewiss ist jedoch, dass dieser die Klaviatur der gängigen Schäferidyllen perfekt beherrschte: Murmelnde ruscelli, säuselnde Zeffiretti, liebliche colli, grünende boschetti, blumenduftende prati und – nach Bedarf – jede Menge uccellini und agnellini... Kurz: Ein im Wortsinn idealer Locus amœnus als Spiegel der seelischen Befindlichkeit der (mehr oder minder glücklich verliebten) Akteure, was wir ja aus unzähligen Opern von Händel & Co., aber auch aus Susannas «Rosen-Arie» im «Figaro» kennen.

Alcidoro, un pastore: Maayan Licht, Sopranist Dalisa, una ninfa: Silvia Frigato, Sopranistin
(Bild: © Nelya Agdeeva)
Abgesehen von dieser toposgeschwängerten Szenerie ist der Plot denkbar einfach: Schäfer Alcidoro liebt Nymphe Dalisa. Doch diese – vorerst eher an Botanik denn an Biologie interessiert – zieht es vor, allein durch die lieblichen Gefilde zu streifen, derweil er leidet und stöhnt. Des Lustwandelns müde, legt sie sich zum Schlummer nieder. Das ist die Stunde Amors: Er zielt und trifft. Dalisa träumt und erwacht und liebt.«Sento che t’amo», seufzt sie. «Dolce mia vita», schmachtet Alcidoro. «Viva il dio, cui tutto serve», jubelt der Chor (Es lebe der Gott, dem alles dient).

Schlosstheater Schwetzingen, erbaut 1752 von Nicolas de Pigage (1723 –1796)
Nun, nach exakt 251 Jahren, wurde das reizende Werk reanimiert und erneut aufgeführt, just im charmanten Schwetzinger Rokoko-Theater. Und zwar als halbszenisches Hörtheater: Knallbunte exzentrische Kostüme. Ein (weiblicher) Amor, der über Liebe und Sex, über Nähe, Intimität und Übergriffigkeit räsoniert. Ein neukomponiertes, mäßig modernes Chorstück sowie allerlei Geräusche und eher gesuchte, wenn nicht gar überflüssige Überschreibungen und Hinzufügungen.

Schwetzinger Aufführung mit Julia Lezhneva (l.) und Maayan Licht in extravaganten Kostümen
(© SWR – Fernando Fath)
Dazu muss ich präzisieren, dass ich nur den Mitschnitt auf SWR-Kultur gehört habe, der mich nicht sonderlich überzeugte – abgesehen natürlich von der Musik selbst, die mitunter an Gluck, an Mozart und Stamitz erinnert, und doch mit ganz eigenständigem Idiom und aparten Klangfarben überrascht. Ich hatte jedoch die Gelegenheit, zwei Tage später eine Aufführung in der ehemaligen Klosterkirche – heute das Steigenberger Inselhotel – in Konstanz zu hören, und zwar pur, ohne jegliche Zutaten.
Musikalische Kuckuckseier
Das heisst, nicht ganz: In Bachs Partitur fehlen zwei nicht unwesentliche Nummern: die Ouvertüre und – ausgerechnet! – die bedeutungsvolle Ballettszene rund um den Auftritt des Liebesschützen. Der musikalische Leiter Jörg Halubek hat aus dieser Not eine fabelhafte Tugend gemacht, indem er zwei musikalische «Kuckuckseier» in Bachs Komposition einschleuste, die sich perfekt einfügen, stellen sie doch gleichzeitig eine Hommage an die Historizität des Werks, seinen musikalischen Kontext und seinen Aufführungsort dar.

Das fehlende Eingangsspiel ersetzt Halubek nicht durch eine der zahlreichen Sinfonien des Komponisten selbst, was nahe gelegen hätte, sondern, wie es üblich war, durch die Sinfonie (op. 10, Nr. 6) eines Zeitgenossen Christian Cannabich (1731–1798), Geiger und später Kapellmeister des Mannheimers Hoforchesters, das seinerzeit als eines der besten in ganz Europa galt (auch hier wieder eine Verbindung zu Mozart, mit dem ihn eine menschliche und künstlerische Freundschaft verband). Das sinnenfreudige, frische dreisätzige Werk passt – besonders mit seinem pastoral-empfindsamen Mittelsatz ohne Bläser – ausgezeichnet zum Kommenden.
Für die Ballettszene, wo wir uns vielleicht eine Schar kichernder, kapriziöser Nymphen auf der Flucht vor Amors Pfeilen vorstellen möchten, wählte man den 3. Satz, Minuetto, aus einem Flötenkonzert, G-Dur, von Johann Baptist Wendling (1723–1797), ebenfalls zum Kreis der Mannheimer gehörig und neben seiner Position als 1. Flötist Musiklehrer des Kurfürsten. Auch Wendling war ein Freund Mozarts, der ihn – selbst als Flötist! – außerordentlich schätzte. Claire Genewein an der Traversflöte weiß in ihrem Spiel Empfindsamkeit und Anmut mit Schalk, der sich in fantasievollen Verzierungen ausdrückt, zu verbinden, was problemlos über das fehlende Ballett hinwegtröstet, vielmehr ein solches virtuell geradezu herbeitänzeln lässt.

Wie überhaupt das hochkarätige Ensemble «Il Gusto Barocco» unter der atmenden, unaufgeregten Leitung Halubeks hochmotiviert und lustvoll musiziert, was sich dem Publikum unmittelbar mitteilt, zumal man in Konstanz den Musikern ohne trennenden Orchestergraben direkt gegenübersaß. Besonders beglückend auch das transparente, lebendige Spiel und Gegenspiel, das sich unter den einzelnen Instrumentengruppen entfaltete: Eine geschmeidig-galante Musik voller Grazie, die – über dem zwar noch immer manifesten, aber zunehmend organisch ins Klangbild eingebetteten Generalbass – vielerorts lyrische, besinnlichere Töne anschlägt.

Der 8-stimmige Projektchor rekrutierte sich aus Studierenden der Mannheimer Musikhochschule. Zwar hatte er nur gerade drei Auftritte, formte aber mit subtil austariertem Gesamtklang eine nuancierte, empathische Klangkulisse. Das war auch ausgesprochen schön anzusehn: Die schwarz gekleideten vier Sänger und vier Sängerinnen wurden optisch zur Einheit mit den Instrumentalisten, davor hoben sich die Vokalsolisten, beide in weißen Hosenanzügen, effektvoll ab. Da vermisste man keinerlei weiteres szenisches Beiwerk; die mit Strass verzierten Schühchen des Sopranisten genügten als glamouröser Clin d’œil!
Emotion über Bravoura
Zurzeit erleben wir eine Blütezeit – zum Glück nicht der Kastraten, sondern der Countertenöre aller Schattierungen. Wie die Farinellis und Senesinos geklungen haben, wissen wir nicht, man darf aber davon ausgehen, dass ihre gegenwärtigen Nachfolger ihnen stimmlich kaum nachstehen. Und im Gegensatz zu den aufgeschwemmten, riesenhaften Körpern der umjubelten, armen Evirati von damals machen die heutigen Sopranisten und Altisten auch was her fürs Auge!

Einer von ihnen ist Maayan Licht, ein Sängerschauspieler von umwerfender Energie und Bühnenpräsenz. Er begeisterte mich schon 2022 in Bayreuth in Vincis «Alessandro nell’Indie», jetzt verblüfft und fasziniert er erneut mit stupender Atemtechnik und phänomenaler Höhe. Betörend, wie er einer Koloraturkette klangliche Plastizität verleiht, wie er einen einzelnen Ton stilsicher ein- und umfärben kann. Atemberaubend, wie er sportive Virtuosität in echte Emotion ummünzt, wie er ein Piano gestaltet, ohne dabei an Substanz einzubüßen.
In Schwetzingen hatte Julia Lezhneva (offenbar Maayan Lichts Vorbild und Ansporn in Sachen Koloraturen) die Dalisa gesungen; in Konstanz übernahm Silvia Frigato den Part der spröden Nymphe. Und wie sie das tat: Mit leicht ansprechender und doch charaktervoller Stimme, die auch in den makellosen Spitzentönen und präzisen Koloraturen ihre Wärme und Strahlkraft nicht verliert. Glaubhaft gelingt ihr – selbst ohne szenische Darstellung – der Wandel von der anmutig tändelnden Nymphe zur gefühlvollen Liebenden.

Und wenn sich das sopranistische Traumpaar gegenseitig zu immer halsbrecherischen Höhenflügen und schließlich zu einem gemeinsamen Triller über einen ganzen Takt lang steigert, verschlägt es uns ob der perfekten Intonation und der raffinierten Klangmixtur schier den Atem. Nicht so den beiden... Doch da besiegelt der Chor mit seinem kompakten Schlusslob auf Amor vincitore das vokale Feuerwerk. – Und wir schnappen nach Luft...


Bilder © Bruno Rauch | wikimedia | umz ssg–presse
06.06.2025
Weitere Beiträge finden Sie hier.
Besonders interessieren könnte Sie vielleicht der Artikel über Bayreuth Baroque
Abonnieren Sie die «rauchszeichen» – gratis und franko und ohne jede Verpflichtung!
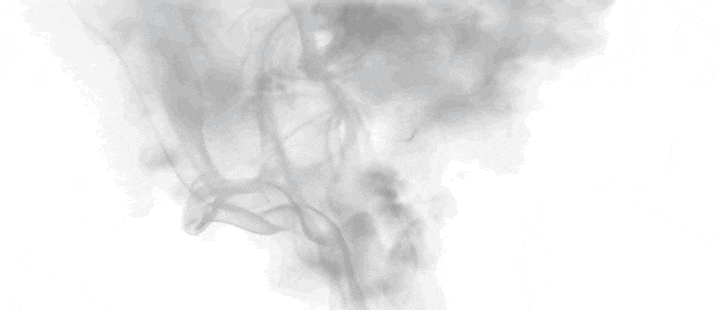

An dieses Konzert wäre ich gern mitgekommen. Ich habe ihn ja letztes Jahr in Bayreuth gehört, und wir schwebten vor Glück einfach wie auf Wolken!
R. W.