Krieg – und alle gehen hin
- Bruno Rauch

- 6. Nov. 2025
- 8 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 14. Dez. 2025
Darf, soll sie auftreten? – Das war die zentrale Frage vor dem geplanten Auftritt von Anna Netrebko als Leonora in Giuseppe Verdis «La forza del destino» am Opernhaus Zürich. Heftig wurde darüber in den letzten Tagen und Wochen in den sozialen Medien und im Feuilleton (und darüber hinaus) diskutiert. Und auch schon mal polemisiert. Dennoch sind alle fünf mit der Sängerin geplanten Vorstellungen ausverkauft...

Hat da jemand behauptet, Oper hätte nichts mit Politik zu tun?
An diesem nassgrauen Premierenabend hatte sich ein gutes Dutzend Menschen mit Ukraine-Flaggen vor dem Opernhaus versammelt und dem zahlreich herbeiströmenden Publikum ein Flugblatt in die Hand gedrückt. Neben der Auflistung des Bekannten war da die Forderung zu lesen, die Sängerin solle ihre Gage den Opfern der russischen Aggression spenden. Alles geschah ruhig, unaufdringlich, fast ein wenig resigniert; auch später im Saal und nach der Vorstellung nichts, was die beiden Bodyguards von Frau Netrebko zum Eingreifen hätte veranlassen können.

Im Vorfeld hatte die hiesige ukrainische Gemeinschaft für eine Ausladung der russisch-österreichischen Sopranistin plädiert; auch die ukrainische Botschafterin hatte das Engagement aufs schärfste kritisiert. Und Opernintendant Matthias Schulz ebenso dezidiert seine Entscheidung verteidigt (dem Programmheft lag sogar der verlinkte Hinweis auf eine entsprechende Stellungnahme in der NZZ bei). Er begründet seine Überzeugung, die er primär als eine künstlerische bezeichnet, damit, dass Netrebko – entgegen ihrer früheren Haltung und Auftritten im Dunstkreis des Kremls – inzwischen den Krieg gegen die Ukraine «ausdrücklich verurteilt habe» (allerdings eher halbherzig und ohne Putin namentlich zu nennen, muss man hinzufügen!).
Aus künstlerischer Sicht wird man ihm nach dem gestrigen Abend rückhaltlos beipflichten: Anna Netrebko ist eine Ausnahmesängerin; die Frage hat sich also irgendwie erledigt. Gelöst, allerdings, ist sie nicht! Und ist vielleicht auch gar nicht schlüssig zu lösen, da wir Außenstehenden die Details und die Konsequenzen für die Künstlerin und ihre Familie nicht kennen und schon gar nicht in die Köpfe der Beteiligten hineinsehen können. Daher sollen hier die hinlänglich vorgebrachten und gleichermaßen berechtigten Pro und Kontra nicht weiter kolportiert werden. Bei allem Wissen um die im Opernbetrieb sehr langfristige Planung bleibt dennoch das schale Gefühl, dass hier unsensibel entschieden wurde, sowohl vom Inhalt als auch vom Zeitpunkt her (abgesehen von der Weltlage ist es erst die zweite Opern-Neuproduktion der neuen Intendanz!)


Im Dezember 1861 reiste das Ehepaar Verdi nach Russland, im Gepäck die neue Oper, ein lukratives Auftragswerk aus St. Petersburg. Wegen Krankheit musste die Uraufführung jedoch um ein Jahr verschoben werden und fand erst ’62 statt. Für die Aufführung von 1869 an der Scala erstellte Verdi eine zweite, etwas abgemilderte Fassung – u. a. mit der großartigen Ouvertüre und textlichen Bereinigungen durch Antonio Ghislanzoni, der 1871 das Libretto zu «Aida» liefern sollte.


Historie und Gegenwart
Gewiss ging es Verdi in seinem «Dramma musicale» nicht nur um eine tragische Liebesgeschichte (Einmal mehr: Vater vereitelt die Liebesbeziehung seines Kindes und löst mit seiner Sturheit eine Kette von Kalamitäten aus). Ihm ging es, wie der Titel andeutet, ebenso um die schicksalshafte, blindwütige Verstrickung der Protagonisten vor wuchtigen martialischen Genretableaus, ja, er bat seinen Librettisten Francesco Maria Piave um zusätzliches Kolorit durch den Beizug von Passagen aus Schillers Kriegstrilogie «Wallenstein», vorab die bekannte «Kapuzinerpredigt», die er dem eifernden Bruder Melitone, hier zwar einem Franziskaner, in den Mund legt.
Neben dem Krieg als treibende, zerstörerische und im eigentlichen Wortsinn fatale Kraft, geht es um Standesdünkel, Blutfehde und Rassenhass. Die Tragödie vollzieht sich auf zwei Ebenen: einer individuellen sowie einer gesamtgesellschaftlichen. Auch die literarische Vorlage zur Oper, das 1835 in Madrid uraufgeführte romantische Schauerstück «Don Álvaro o la fuerza del sino» von Ángel de Saavedra, einem literarisch ambitionierten Offizier und Politiker, spielt vor der Folie des Kriegs. Dort sind es die spanisch-habsburgischen Erbfolgekriege (1740–1748), mit denen die neapolitanisch-spanischen Truppen die von Habsburg-Österreich besetzte Lombardei zurückzuerobern suchten. Dass Verdi, 1861, als frisch ernannter Abgeordneter des sich konstituierenden Nationalstaates an «sein» Italien zur Zeit des Risorgimento dachte, ist nur allzu naheliegend. Das blutige Gemetzel von Solferino (1859), knapp 80 Kilometer von Busseto, Verdis Landsitz entfernt, war eine entscheidende Etappe auf dem Weg der Loslösung vom Habsburgerreich.


Selbst wenn die argentinische Regisseurin Valentina Carrasco mit ihrem opulent-düsteren «Kriegsfresko» dem vorgegebenen Setting folgt, dieses mit cinemascope-artigem Aufwand sogar zuspitzt und emotional erfahrbar zu machen sucht, ist das Unterfangen angesichts der eingangs erwähnten Umstände brisant, fragwürdig oder – wir haben es bereits gesagt – unsensibel. Hinzu kommt, dass ein Krieg auf der Bühne aufgesetzt und eben «inszeniert» wirkt. Da ist eine surrende (Spielzeug-)Drohne oder ein schwanzwedelnder (echter) Hund, der an den Leichen schnuppert, nur peinlich. Ebenso wie eine ambulante Imbissbude, die «Hot War Dogs» anbietet. Sollte mit solchen Episoden allenfalls dem bekannten sarkastischen Humor Verdis, der auch in diesem Werk immer wieder durchschimmert, Genüge getan werden?

Um die Gräuel einem Publikum nahe zu bringen, das kaum kriegerische Erfahrung hat, lässt die Regie den Krieg bis in die bislang verschonte Schweiz vordringen: Menschen werden verletzt, sterben, flüchten, verlieren sich, finden sich wieder, um sich erneut zu verlieren…
Die Gejagten, Versehrten, Flüchtenden sind Leonora und ihr Geliebter Alvaro, sowie Leonoras rachsüchtiger Bruder Carlo. Alvaro, ein Mestize, wird von Leonoras Vater, dem Marchese Calatrava (Stanislav Vorobyov: ein kurzer, aber klangvoller Auftritt), als künftiger Schwiegersohn abgelehnt. Die Liebenden entschließen sich zur Flucht, werden in flagranti gestellt. Alvaro wirft seine Pistole weg, ein Schuss löst sich, der Vater wird tödlich getroffen. Das Paar verliert sich: Leonora sucht Zuflucht im Kloster, denn ihr Bruder verfolgt nicht nur den vermeintlichen Schänder seiner Schwester; um der Familienehre Willen fordert er auch ihren Tod. Auf dem Schlachtfeld begegnen sich die beiden Männer erneut, schwören sich – jeder ohne die wahre Identität des andern zu kennen! – ewige Freundschaft. Carlo setzt sich für die Rettung des verwundeten Alvaro ein. Jahre später stösst er erneut auf den Todfeind, der sein Dasein ebenfalls im Kloster fristet. Carlo fordert ihn zum Duell, unterliegt und ersticht sterbend seine herbeigeeilte Schwester. Zurück bleibt der mit seinem Schicksal hadernde Alvaro…


Noch während der Ouvertüre, deren drei Akkorde im Blech und den Fagotten zweimal drohend aus dem Orchestergraben emporsteigen und das unruhig flackernde Agitato ausbricht – das Zürcher Opernorchester unter seinem Chefdirigenten Gianandera Noseda schlägt uns vom ersten Augenblick an in Bann –, ploppen Eilmeldungen auf. Karten werden projiziert. News tickern über den schwarzen Vorhang: Schweiz im Kriegszustand. Regierungsrat evakuiert. Angriff aus dem Osten. St. Gallen, Wil und Winterthur besetzt. Vielerorts massive Schäden durch feindlichen Beschuss. Auch in der neobarocken Fassade des Firmensitzes der Z-Versicherung, jetzt als Stadtpalais der Calatravas umgedeutet, klafft anstelle des Fensters im ersten Stock ein riesiges Loch. Hier nimmt das Schicksal seinen Lauf, hier löst sich der verhängnisvolle Schuss, hier beginnt die traumatische Odyssee. (Dass Leonora und ihre Zofe mit Shopping-Bags enteilen, nachdem die Flucht ja lange geplant war, ist ein weiterer kleiner, aber irritierender Missgriff der Regie.)


Quer durch die havarierte Schweiz
Später führen uns die Bühnenbilder von Carles Berga, großflächige Gebäudefotografien, montiert auf ein drehbares Holzgerüst, zu weiteren Schauplätzen dieser dystopischen Schweiz. Im nächsten Bild ist es das Genfer Palais des Nations mit seiner Flaggen-Allee, von denen einige bereits geknickt sind. Vor der havarierten Fassade wogt eine schutzsuchende Menschenmasse. Kostümbildnerin Silvia Aymonino scheint Kostüme und Kopfbedeckungen aus der halben Welt zusammengetragen zu haben, um die Internationalität der hier Gestrandeten zu unterstreichen. Da finden sich Militaristen. Ordnungskräfte, Blauhelme, Prälaten, Touristen, Rotkreuztruppen, medizinisches Personal, Kriegsberichterstatter, Kriegsgewinnler…


Mitten drin – Geschäft ist Geschäft, auch und erst recht im kriegerischen Ausnahmezustand – Preziosilla, ein weiblicher Haudegen mit (allzu) oft hochgereckter Faust, Marketenderin und Kriegstreiberin, die Pistolen und Granaten verkauft, sich aufs Handlesen versteht und den als Studenten getarnten Carlos nicht nur durchschaut, sondern im Armwrestling mühelos besiegt: Annalisa Stroppa bringt mit ihrem frischen, agilen Mezzosopran Witz, ironischen Biss und Leichtigkeit in den Schrecken und lässt im nonchalanten Gebaren mitunter auch eine unterschwellige Dämonie mitschwingen. In einer späteren Szene – wir sind mittlerweile vor dem von Granateneinschüssen gezeichneten Kongresszentrum in Davos – wird sie die Soldaten gar zum Russischen Roulette animieren.
Im folgenden Bild entgleist die Inszenierung völlig: Leonora flüchtet sich in ein Kloster: die zerbombte Fraumünsterkirche, links und rechts ramponierte Säulenschäfte, die halbe Kanzel wurde weggerissen, nur das gestirnte Apsis-Gewölbe und die Chagall-Fenster sind noch intakt (man hat offenbar vergessen, sie rechtzeitig auszubauen). Hier wird sie von Pater Guardian – Michele Pertusi verströmt Trost und Empathie mit noblem, väterlichem Bass – empfangen, nachdem er zuvor ganz korrekt ihre Papiere kontrolliert hat. Für ihren Klostereintritt wird Leonore eingekleidet, nicht etwa in eine Kutte, denn schließlich tragen auch die Mönche Kampfanzug, Béret oder Helm. Ihr werden die Haare geschnitten, eine kugelsichere Weste umgelegt, eine Matrikelnummer in den Unterarm tätowiert. Und eine Schusswaffe in die Hand gedrückt… Ist das mutig, ist das unbedarft? Von der Regie, von der Darstellerin, der Dramaturgie, der Intendanz?

Leonora singt jedenfalls um ihren Seelenfrieden, und das wohl gleich in mehrfacher Hinsicht. Und wie die Netrebko das tut! Klang ihre Stimme zu Beginn des Abends (begreiflicherweise) noch leicht angespannt, so entfaltet sie jetzt ihren einmaligen Zauber. Sie ist schlanker, heller geworden, ohne die samtige Fülle einzubüssen. In perfekter Überblendung verbindet die Sängerin die Register, strahlt in makelloser Höhe, bezaubert mit auf dem Atem gesungener Kantilene, setzt das Vibrato sparsam und gezielt ein, berührt mit stupenden Piani. In diesem moralisch defekten Umfeld verleiht sie so der Figur eine Dringlichkeit, der man sich nicht entziehen kann, zugespitzt formuliert: Ihre Leonora überzeugt im Vokalen mehr als im Darstellerischen. Wie sich die Personenführung überhaupt generell auf malerische Posen an der Rampe beschränkt.


Der Krieg geht weiter, auch die Bühne dreht weiter. Noch mehr Soldaten, noch mehr Menschen auf der Flucht. Der Pulverdampf wabert, und leise rieselt der Schnee. Man ist – wohl beabsichtigt – ziemlich desorientiert. Der Chor, mit Zuzügern, Kindern und Statisten aufgestockt, zeigt stimmlich eindrückliche Präsenz und sorgt für klangmächtige Momente, auch wenn er von der Regie eher vernachlässigt wird. Roberto Frontali brilliert als grantelnder Fra Melitone, der die Armensuppe verteilt und gleichzeitig dem marodierenden Soldatenpack eine saftige Standpauke verpasst: ein köstliches Kabinettstück von echt verdianischem Zuschnitt, indem er frech bottiglie auf battaglie reimt.

Carlo, noch immer vom Rachegedanken getrieben, irrt ebenfalls durch die Lande. Eine Bühnenfigur, die alles andere als ein Sympathieträger ist; George Peteans fein nuancierter, unangestrengt strömender Bariton ist vielleicht fast etwas zu nobel für diesen verbohrten Charakter, ihm zuzuhören ist dennoch ein Genuss. – Nun karrt ein Rotkreuz-Jeep den verwundeten Alvaro herbei: Gelegenheit zum famosen Duett, einem der zahlreichen emotionalen Höhepunkte der Oper. Yusif Eyvazov als Alvaro verfügt über tenorale St(r)ahlkraft, ein eher monochromes Timbre und scheinbar unerschöpfliche stimmliche Reserven. Er ist nicht der Mann der leisen Töne noch des emotionalen Feinschliffs, weiß aber seine vokalen Mittel doch so zu differenzieren, dass das leidenschaftliche Abschiedsduett große Wirkung erzielt – und entsprechenden Szenenapplaus.

Diese immer wieder packende Verdichtung von Klang und Szene ist natürlich das große Verdienst des Orchesters der Oper Zürich und des Dirigenten. Was sich in den ersten Takten der Ouvertüre angekündigt hat, hat sich im Laufe des Abends immer wieder bestätigt: Glühende Farben, geschärfte Transparenz, atmender Raum für große Gefühle begleiten und erzählen das doch ziemlich krude Geschehen, sodass eine äußerst spannende Balance zwischen martialischem Vorwärtsdrang und einem immer wieder aufkeimenden Hoffnungsschimmer entsteht.


Zum Countdown findet man sich im Plenarsaal des Völkerpalasts wieder. Wie Leonora aus dem Kloster dahin gelangt ist? Eine weitere Ungereimtheit der Regie, über die man hinwegsehen kann, weil Netrebko ihrem Friedensgebet «Pace, mio dio!» ergreifende Dringlichkeit und Intensität verleiht. Da mögen Oper und Welt, Kunstwerk und Realität, Figur und ihre Interpretin für einen dichten Moment zusammenfinden. Dass dagegen die Regie Leonora ausgerechnet hier, im Saal des Weltfriedens und nach ihrer Arie, mit einem Maschinengewehr auftreten lässt, ist, um den Bogen zum Anfang zu schlagen, äußerst unsensibel. Mehr als das: Es ist schlicht ignorant.

Szenenbilder: © OHZ – Monika Rittershaus
05.11.2025
Weitere Beiträge finden Sie hier.
Abonnieren Sie die «rauchszeichen» – gratis und franko und ohne jede Verpflichtung!
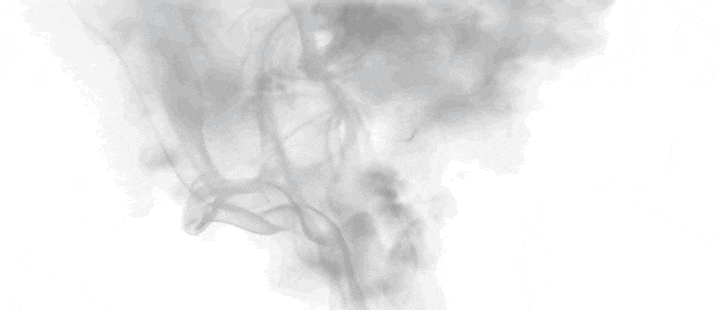


Deine musikalische Einschätzung (Sänger, Dirigent, Orchester) entspricht ja der allgemeinen Rezeption und auch meiner Meinung. An deiner Kritik gefällt mir aber ganz besonders die Einordnung der Regiearbeit. Zweitens finde ich auch deine Einstellung zur Trennung von Oper (Musik) und Politik sehr richtig.
Toll, Dein Beitrag. Ich staune über Dein Wissen und Deine Kenntnisse.
MS
Wunderbarer Bericht (auch zwischen den Zeilen). Für mich eine Aufführung statt mit Maske (Covid) mit Augenbinde. Halt einfach schade und nur 50% Genuss.
NN
Einfach hervorragend, und danke, lieber Bruno. Besser kann nicht darüber geschrieben werden. Im Gegensatz zu andern Opern, wo ich zu einem geplanten Opernbesuch deine Beiträge vorgängig zur Einführung und/oder nachträglich als differenzierte Interpretation lese, bleibt's diesmal ohne Opernbesuch, lieber bei deinem "wohltuenden" und eben differenzierten Bericht: Bravo e grazie mille!💖
Danke für diesen ausgewogenen Text. Bin aber froh, selbst nicht dabei gewesen zu sein.