Als wir noch fliegen konnten...
- Bruno Rauch

- vor 2 Tagen
- 9 Min. Lesezeit
Aktualisiert: vor 31 Minuten

Nicht nur zur Weihnachtszeit – aber jetzt ganz besonders – wurde und wird Engelbert Humperdincks «Kinderstubenweihfestspiel» auf zahlreichen Opernbühnen quer durch die Lande aufgeführt (als «Weihfestspiel für die Kinderstube» apostrophierte der Komponist in koketter Bescheidenheit, in Verehrung Wagners und gleichzeitig auch Abgrenzung von dessen «Parsifal» seine Oper «Hänsel und Gretel»; immerhin geht es ja auch hier um Verführung und Erlösung). So mag denn auch das Opernhaus Zürich diesen Dauerbrenner getrost aufs Programm setzen – und sogar live in diverse Kinos des Kantons übertragen. Mit positivem Echo aus den Kinosälen, die – so das Opernhaus – offen für weitere derartige Projekt seien.


Warum diese Märchenoper, mit der sich der Komponist einen Platz im Parnassus operisticus gesichert hat, zum Weihnachtsstück par excellence wurde, könnte in einer spitzfindigen – und wohl ziemlich überflüssigen – Abhandlung erörtert werden. Darum hier nur so viel: Das Werk wurde tatsächlich am 23. Dezember 1893 im Weimarer Hoftheater uraufgeführt – mit unerwartet großem Erfolg und, notabene, unter Leitung von Richard Strauss. Daraus entwickelte sich schon bald eine Aufführungstradition im Advent. Genau dreißig Jahre später, 1923, erklang das Werk auch als erste integrale Übertragung einer Oper am Rundfunk (Covent Garden/BBC)!

Die suggestive, eingängige Musik, durchsetzt mit volksliedhaften Melodien zum Mitsummen, die märchenhaft-warme Atmosphäre, der animistisch belebte Wald, die geheimnisvoll-gruselige Dunkelheit und schliesslich die Geborgenheit und Eintracht, all dies fügt sich zu einer einzigartigen Mischung, die in unseren Ohren nach Muskat und Zimt duftet und das Werk zur idealen Familienoper macht. Darüber hinaus lässt sich das Stück in vielerlei Gestalt, sogar reduziert auf zwei Sängerinnen und Klavier, aufführen, mit geringem Bühnenaufwand oder aber fantastischem Theaterzauber. Und schliesslich – das wissen wir spätestens seit Freud und expliziter noch C. G. Jung, vor allem aber seit Bruno Bettelheim – erlauben Märchen eine Vielzahl von (tiefen)psychologischen Deutungen, bieten sich an als ideale Spielwiese für Regieideen – subtile und oft auch weniger subtile! Das Spektrum reicht von Sozialkritik über Kindheitstrauma, Kindsmissbrauch, Konsumwahn bis – horribile dictu – Kannibalismus…

Von der Stube auf die Opernbühne
Thom Luz, der hier seine erste Opern-Regie vorlegt, sucht einen anderen Deutungsweg, und kommt dabei, obwohl er sich vordergründig oft ziemlich weit von der Vorlage entfernt, paradoxerweise dem Geist – besser: dem Zauber – des Märchens auf seine Weise zumindest partiell erstaunlich nahe. Er beruft sich dabei auf sein eigenes «Erweckungsmoment», das ihm als Achtjährigem im damaligen Stadttheater Zürich widerfuhr. Gleichzeitig macht seine Inszenierung auch klar, dass es sich bei diesem Werk nicht ausschließlich um eine Kinderoper handelt. Dank ihrer Vielschichtigkeit vermag sie Kinder dennoch in Bann zu ziehen.
Die Entstehung der Oper selbst folgt ebenfalls einem Wandel vom naiven Märchenspiel zur veritablen Oper. Über Humperdincks Inspiration kursieren diverse Varianten: Für ein Puppenspiel im häuslichen Kreise sollte er auf Bitte seiner Schwester Adelheid Wette für ein von ihr verfasstes Puppenspiel nach dem bekannten Grimm-Märchen ein paar Musikstücke beisteuern, «etwas recht Hübsches, Volkstümliches». Der Komponist muss an dieser Aufgabe derart Gefallen gefunden haben, dass er vom Stoff nicht mehr loskam. Aus den ursprünglichen vier Liedern wurde zunächst ein kleines Singspiel. Und noch später erweiterte er das «Flickwerk», wie er’s nannte, zur abendfüllenden durchkomponierten Oper, die volkstümliche Schlichtheit mit sinfonischer Dichte verbindet. Anderen Quellen zufolge soll Cosima Wagner den Komponisten 1890, anlässlich eines gemeinsamen Ausflugs, zur Stoffwahl ermuntert haben, basierend auf dem Libretto der Schwester und deren Gatten Hermann Wette, einem Arzt mit literarischen Ambitionen.

Engelbert Humperdinck (1854–1921) Gebrüder Grimm, Wilhelm (1786–1859) und Jacob (1785–1863)
Ergäbe das nicht ein reizvolles Genrebild, möglicherweise gar eine Inspiration für eine Regie? – Das Autoren-Trio in der großbürgerlichen, dunkelgetäferten Stube, im trauten Schein eines Gaslichts, an Sprache und Szene feilend, tunlichst darauf bedacht, die «grimmigen» Aspekte des Originals der beiden Märchenonkel Jacob und Wilhelm etwas abzumildern und dafür heitere Motive aus anderen Erzählungen von Hauff, Bechstein, Arnim und Brentano sowie volkskundlich tradierte Elemente wie die Schutzengelsymbolik oder das Sandmännchen einzubringen Das Ganze ist unterfüttert mit wilhelminischer Moral, zeitgeistigen Klischees und Erziehungsidealen und überzogen von einem Zuckerguss aus Diminutiven – Männlein, Käpplein, Fingerlein, Füsschen, Händchen, Engelein, Armsünderlein… Kurz: Ein märchenhaft verpacktes Manifest bürgerlicher Werte, vom Komponisten liebenswürdig und warmherzig gestaltet.

Wie auch immer der Gestaltungsprozess vonstatten ging, Humperdinck hat hier jedenfalls auf glückhafte Weise seinen Stoff gefunden und formuliert dies auch in einem Brief an Wagners Witwe:
«Zum ersten Male in meinem Leben fand ich ein Thema, das meinen geringen Fähigkeiten wirklich entsprach und mich veranlassen durfte, den mir von meinen Konservatoriumsjahren noch immer anhaftenden Ballast von ho|[h]lem Pathos fröhlich abzuwerfen und mein Heil auf dem Gebiet der Kleinmalerei nach Art der Niederländer zu suchen.» (11.Mai 1891)
(«Hümpchen», wie er im Freundeskreis genannt wurde, dürfte dabei weniger an Rembrandt und Rubens gedacht haben als an Jan Brueghel, Gerrit Dou oder Frans van Mieris.)

Es ist just dieser Aspekt der «Kleinmalerei», der mitunter dazu führt, das Stück allzu putzig und niedlich mit erwachsenen Sängerinnen zu inszenieren, die mehr kindisch als kindlich agieren. Oder dann das Werk, wie erwähnt, krass gegen den Strich zu bürsten und mit tiefsinniger Bedeutungsschwere zu überfrachten.
Beides ist nicht Sache von Thom Luz. Vielmehr wirft er für uns, die Kleinen wie die Großen, die Theatermaschinerie an, lüftet den Deckel der magischen Trickkiste und entfacht so einen faszinierenden Zauber. Zauber der Ent-Zauberung, könnte man sein Regiekonzept vielleicht charakterisieren – oder heutiger: the making-of.

So blicken wir denn zu Beginn in einen nackten Bühnenraum: Schlichtes Arbeitslicht erhellt rohe Kulissenstellwände, Scheinwerfer-Racks, Bühnenarbeiter, die da und dort noch etwas adjustieren, einen Tisch, zwei Stühle, ein Puppenhaus herbeitragen… Von Märchenstimmung vorerst keine Spur. Doch dann setzt sich eine befrackte Gestalt ans Klavier im Hintergrund. Und, oh Theater-Wunder, sie, die Pianistin Anna Hauner am sogenannten Lichtklavier – jede Taste dynamisch mit einem Lichtspot verbunden – bringt zur weihevollen Hörnerweise aus dem Orchestergraben die Glühwürmchen im Wald oder die Sterne am Bühnenhimmel zum Schimmern und Funkeln. Und schon erliegen wir ein erstes Mal der Magie des Theaters.


Gleichsam als Reverenz an die im 19. Jahrhundert beliebten Schattentheater senkt sich ein Mullvorhang herab und wird zur Projektionsfläche für ein Schattenspiel des geschäftigen Hin und Hers der Instrumentalisten. Derweil die atmosphärische Ouvertüre munter zu den Kinderliedern und dem hexischen Hokuspokus bis zum finalen erlösenden C-Dur fortschreitet, hastet da eine Cello-Silhouette über die Gazewand, schiebt sich dort der Scherenschnitt einer eleganten Harfe durchs Gewimmel, stolziert hier der kammartige Schattenriss eines Röhrenglockenspiels vorbei, erscheint der Schemen der strammen Trompeten, einer mächtigen Tuba gar, deren Trichter im Schattenwurf als Riesenkopf ihres Spielers erscheint… So «profiliert» haben wir die (Musiker-)Statisten noch nie erlebt!

Dieses Schattenorchester ist gleichsam das Ab- und Ebenbild der Musik, deren Zauber letztlich nie ganz zu fassen ist: Witzig, wenn die Schnecken der Streichinstrumente durch die Luft tanzen, rätselhaft, mitunter phantasmagorisch oder sogar gefährlich, wenn im «Hexenritt» die aggressiven Spitzen der Geigenbögen wie hitchcocksche Vögel auf die verirrten Kinder im Wald einstechen. Poetisch dagegen, wenn die Bäume des Walds mit flirrendem Laub über die Fläche spazieren. Und unheimlich, wenn sich der Schattenwurf der spinnenfingrigen Hexe ins Gigantische verzerrt. (So ganz nebenbei eine feine Anregung, zuhause wieder mal Schattengeschichten an eine Wand zu zaubern!)



Auf den Flügeln der Fantasie
Anregend für Fantasie und Köpfchen geht es weiter. Wie um dieses Neben- und Ineinander von Dichtung und Wahrheit zu unterstreichen, wird jetzt ein strahlend weißes Modell des Opernhauses selbst hereingefahren. Offenbar hat die Hexe das renommierte Architektenteam Helmer und Fellner für den Bau ihrer Knusperkate engagiert; ein witzig-ironischer Hinweis auf den Zuckerbäcker-Traumtempel, der auch uns, große und kleine Kinder, immer wieder mit (musikalischem) Naschwerk und (klanglichen) Leckereien verführt.

Das Stadttheater bzw. Opernhaus wird zum Haxenhaus

Dann erscheinen einzelne Kulissenteile; vor unseren Augen entsteht die Hütte der Besenbinderfamilie; Vater Peter scheint zwar eher im Malergewerbe tätig zu sein, wie die herbeigekarrten Farbkübel andeuten. Ermuntert von den beiden erwachsenen Sängerinnen, die den Geschwistern Hänsel und Gretel, dargestellt von zwei 8- oder 9-jährigen Kindern, als Begleiterinnen, Ratgeberinnen und Beschützerinnen beistehen, tauchen die Kids ihre Hände in die Farbe, um die Wände lustvoll zu beschmieren. Auch aus dem Topf, der im Zorngewitter der erbosten Mutter über den Schabernack der «ungezogenen Wichte» zu Bruch geht, ergiesst sich nicht Milch, sondern – richtig! – weiße Farbe. Und wenn Papa Peter von seiner offenbar erfolgreichen Verkaufstour mit Farbrollern und -walzen leicht angesäuselt heimkehrt, effektvoll aus der Versenkung aufsteigend, bringt er – wen wundert’s – eine ganze Batterie von Farbtöpfen mit. Später lassen die Bühnentechniker, die mit ihrem Wirken aktiven Anteil am Bühnengeschehen haben, dank Farbeimern und Malerrollen ganze Baumstämme in den Himmel wachsen. Ein anderes Mal hüllen die schwarzgekleideten Kulissenmagier mit ihren Dampfgeräten den imaginierten Wald in schaurige Nebelschleier und unheilvolle Rauchschwaden aus dem Hexenofen. Schließlich verhelfen sie den Kinderträumen zum Fliegen, indem sie einen Teil der Kinderschar, gesichert an Seilzügen, als Lebkuchenkinder, Schutzengel oder Elfen auf- und niederschweben lassen – ein bisschen Zauberflöte, ein bisschen Sommernachtstraum, ein bisschen Peter Pan… und ganz viel Poesie, wenn auch gar nicht unbedingt diejenige der Brüder Grimm.



Dass die Poesie ihre magische Wirkung entfaltet, verdankt sich nicht nur den stimmungsvollen optischen Eindrücken (Bühne: Michael Köpke, Kostüme und Licht: Tina Bleuler/Elfried Roller, Video: Tieni Burkhalter), sondern ebenso den engagierten Sängern und Statisten. Zu den beiden Titelfiguren gesellen sich spielend und singend als steife Lebkuchenkinder oder quicklebendige Rasselbande der Kinderchor und die SoprAlti (die etwas älteren Jugendlichen, beide einstudiert von Klaas-Jan de Groot). Für die eigentlichen Protagonisten und ihre zum Teil anspruchsvollen Gesangspartien sind versierte Opernstimmen gefragt, fünf Sängerinnen und ein Sänger, die lustvoll und immer wieder überraschend im schillernden Zwischenreich zwischen behaupteten Märchenfiguren und realen Bühnenkünstlern agieren.

Hänsel und Gretel und ... ...Hänsel und Gretel
Die Mezzosopranistin Svetlina Stoyanova als Hänsel und die Sopranistin Christina Gansch als Gretel sind ein bezauberndes Geschwisterpaar. Mit ihren hell timbrierten jungen Stimmen erfüllen sie das erwartete Rollenbild spielend, unterlaufen es aber gleichzeitig charmant-subtil: beide in gleichen Kleidern mit proper weißen Kragen wie ihre kindlichen Doubles, aber Hänsel mit wallender Lockenpracht, Gretel mit akkurater Kurzhaarfrisur. Frisch und tändelnd erklingt das kindliche Allotria «Brüderchen, komm tanz’ mit mir». Mit filigraner Transparenz bezaubert das Lied vom «Männlein mit dem Purpurmäntlein und dem schwarz’ Käpplein» – nicht der giftige Fliegenpilz, sondern die dralle Hagebutte ist gemeint. Es überrascht daher auch nicht, dass Hänsel statt Beeren kleine Irrlichter in sein Körbchen sammelt und sie, statt zu verspeisen, mir nichts, dir nichts auslöscht. Im innigen «Abendsegen» schließlich scheint sich tatsächlich ein Stück vom Paradies auf die Schlafenden herabzusenken, nachdem Marie Lombard mit silberglänzendem Sopran die Kinder in den Schlaf gesungen hat – als Sandmännchen in Frack und Fliege wie ein Dirigent; und prompt huscht nach dem kurzen Auftritt wieder einer der schwarzen Backstage-Gnomen herbei, um dem Star ein Blumenbouquet zu überreichen. Sylwia Salamońska-Bączyks strahlender Sopran, ihr pompöser Reifrock und das gleißende Diadem machen aus dem Taumännchen eine opernhafte Zauber-Diva, die mit Fingerschnippen und Spitzentönen die Lichter im Saal aufflammen lässt.


Jochen Schmeckenbechers Peter Besenbinder strahlt bodenständige Jovialität aus, gepaart mit baritonalem Stimmenglanz in allen Facetten: Großspurig schwadronierend über seine Verkaufserfolge, väterlich liebevoll besorgt um die verirrten Kinder, theatralisch auftrumpfend beim Bericht über das wüste Treiben der Hexe.
Rosie Aldrige verkörpert – lassen wir mal die Psychologie außen vor! – sowohl die Mutter als auch die Hexe. Ein imposantes Organ, eine beeindruckende Präsenz; als «madre al borde de un attaque de nervios» ein wenig zu stimmgewaltig. Als glamouröse Hexe dagegen – hohe Plateausohlen, üppiger Rapunzelzopf, schwarzes Kostüm, oft mit Cocktail-Glas in der Hand – erscheint sie wie eine Figur aus einem Gothic-Comic; dazu passen ihre vokale Durchschlagskraft und stählerne Schärfe perfekt. Offenbar verfügt das teuflische Weib sogar über eine musische Ader, indem sie die Kinder in ein Klavier steckt, um sie für den späteren Verzehr weichzuklimpern. Prompt streckt ihr der pfiffige Hänsel beim Fingertest ein Klavierhämmerchen entgegen. (Ob da der Regisseur möglicherweise sein eigenes pianistisches Kindheitstrauma abarbeitet?) Zu solch augenzwinkernden Aperçus passt es jedenfalls, dass die böse Dame nicht im Feuerofen endet, sondern den Qualm für einen eleganten Abgang nutzt, um in einer Loge ihrer Opernvilla zu verschwinden – natürlich eskortiert von einem ihrer Trabanten – dem Schlagi (Ondrej Graf) oder dem Stechi (Leon Blohm)…

Ob Volkston oder opernhafte Attitüde, das Orchester der Zürcher Oper unter der litauischen Dirigentin Giedrė Šlekytė schöpft die reiche Klangpalette und das emotionale Spektrum genüsslich aus. Ob mit fein ziselierendem Silberstift konturiert oder farbtrunkenem, dickem Pinsel gemalt, das Orchester ist hellwach und engagiert bei der Sache, an allzu pastos geratenen Passagen wird in den Folgevorstellungen sicherlich noch gefeilt, was auch dem subkutanen Witz dieser exquisiten Partitur noch pointierter Rechnung tragen würde. Jedenfalls verbinden sich Klangmagie und Bühnenzauber aufs Prächtigste, sodass die gut zwei Stunden wie im Flug vergehen.

Post scriptum
Thom Luz’ doppeldeutige Regie hat mich an ein schmales Büchlein in meinem Regal erinnert, das frech neben der Grimmschen Gesamtausgabe steht: Hans Traxlers kleine Meistergroteske aus den 1960ern, heute fast prophetisch in Sachen Fake News und Faktenmanipulation. Ein Werk, das sich an einem Abend verschlingen lässt wie ein Lebkuchenherz (jedoch ohne schwer aufzuliegen!).
Traxler enthüllt darin, dass sich die Grimms für ihre Erzählung eines realen Kriminalfalls aus dem 17. Jahrhundert bedienten. Im Zentrum steht der Nürnberger Bäcker Hans Metzler, ein erfolgloser Freier, der unbedingt an das streng gehütete Lebkuchenrezept der Katharina Schraderin (1618-1647) wollte. Sie gab ihm einen Korb – worauf er sie kurzerhand als Hexe denunzierte.
Seltenheit in der Rechtsgeschichte: Trotz peniblem Verhör und Folter wurde die standhafte Katharina freigesprochen. Also griff Metzler, unterstützt von seiner Schwester Grete, zum letzten Mittel: Mord, Leiche in den Ofen, fieberhafte Suche nach dem Rezept – ohne Erfolg. Gefunden wurde dafür der Stoff für eines der berühmtesten Märchen.
Und für eine schöne Oper!


Szenenbilder: © OHZ – Herwig Prammer
23.11.2025
Weitere Beiträge finden Sie hier.
Abonnieren Sie die «rauchszeichen» – gratis und franko und ohne jede Verpflichtung!

Neu aufgelegt.bei Reclam:
Hans Traxler: Die Wahrheit über Hänsel und Gretel
D-Dietzingen, 2007
ISBN 978-3-15-018495-0
Oder als Hörspiel-Krimi in der ARD–Audiothek:
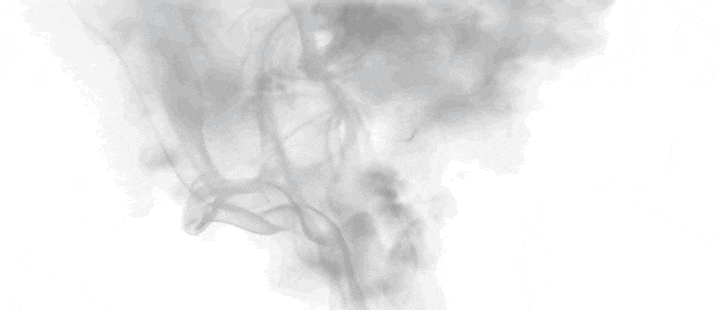

Kurz und bündig: ein Geniestreich! Hab wieder ganz viel gelernt, und werde mir den Krimi mal reinziehen, passt doch in diese langen dunklen Abende! Gruss und Dank!
P. H.