Tausend rote, tausend gelbe …
- Bruno Rauch

- 5. März 2022
- 7 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 13. Apr.
Eine Tulpe macht noch keinen Frühling. Darum kommt sie auch selten allein, sondern gleich zu zehntausenden! Und in einer Vielfalt von Farben, die die steifen Osterglocken gelb werden lassen vor Neid.

Allerdings: Nachhaltig vergällt hat mir die Frühlingsbotin jener Zeichenlehrer, der uns die stramme Holländerin alle Jahre wieder zum Abzeichnen vorsetzte. Tulpen! Etwas Langweiligeres für angehende Mal- und Zeichengenies gibt es ja nicht! Sechs banale, ovale Kronblätter, ein ebenmäßiger Stiel und ein paar langgezogene, spitz zulaufende Blätter. Ich habe sie gehasst, diese Tulpen, genauso wie die obligaten Aufsätze «Mein schönstes Ferienerlebnis».
Auch ein Schunkel-Schlager aus den 1950er-Jahren, der Amsterdams Tulpensegen – «tausend rote, tausend gelbe, alle wünschen dir dasselbe...» – im Dreivierteltakt besingt, war ebenfalls nicht dazu angetan, meine Beziehung zur Tulpe grundsätzlich zu verbessern. Zudem weiss man, dass in Schlagern gerade in Sachen Liebe und Treue maßlos übertrieben wird. Da war doch Gilbert Bécauds Chanson ganz was anderes: «L’important, c’est la rose» – oder kann man sich vorstellen, dass Monsieur 100’000-Volt einer simplen Tulpe mit der gleichen poetischen und sängerischen Inbrunst gehuldigt hätte? Selbst Saint-Exupérys «Kleiner Prinz», den wir in der damaligen Frankophilie verschlangen, hegt seine puerilen Gefühle mitnichten gegenüber einer Tulpe – bewahre! Eine Rose muss es sein.
Doch zurück zur Tulpenflut. Selbst wenn der Jan aus dem erwähnten Song seiner geliebten Antje noch mehrere tausend draufgäbe – weiss, orange- oder pinkfarben, gestreift, geflammt oder fast schwärzlich –, die Menge an Blüten, die, in Holland maschinell geerntet, gebündelt und verpackt, in die Schweiz gelangen, wäre bei weitem nicht erreicht.

Der Schweizerischen Oberzolldirektion ist die Farbpracht allerdings sowas von schnuppe. Dagegen liefert sie exakte Zahlen: So stammen allein aus Holland, das 99 Prozent des Gesamtimports liefert, jeweils rund 2’500’000 kg «Tulpen, frisch, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken», wie es in der Zollstatistik heisst. Das entspricht einem Einfuhrwert von rund 22’400'000 Franken. Das Covid-Jahr 2020, so erfährt man weiter, wies den tiefsten Wert der letzten Jahre auf, nämlich «nur» 1’600'000 kg. Bescheidene 16’000 kg stammen aus unseren Nachbarländern, darunter beispielsweise jene edlen, grossblütigen crème- oder lachsfarbenen Tulipes du Var aus dem französischen Département Var, deren Stiele sich in der Vase wie elegante Schwanenhälse biegen. Für Schnittblumen besteht übrigens zum Schutz der hiesigen Produktion eine Kontingentierung von Mai und bis Oktober; die Einfuhr von Tulpen zwischen Weihnachten und Ostern ist davon also nicht betroffen.
Schweizer Tulpen sind fast ebenso rar wie die berühmte blaue Tulpe, von der die Züchter seit Generationen träumen. Doch selbst was an Tulpen in teurer Schweizer Erde sprießt, stammt zur Hauptsache ebenfalls aus Holland in Form von Zwiebeln; gut 800'000 kg werden jährlich eingeführt.

Vom Bosporus an die Nordsee
Die ursprüngliche Heimat der Tulpe liegt jedoch keineswegs an den kühlen Gestaden der Nordsee, wo im Umfeld von Amsterdam auf rund 6600 Hektaren etwa 1,6 Milliarden Zwiebeln – Bulben, wie der Fachmann sagt – kultiviert werden. Die Wiege der edlen Schönen stand am Bosporus. Auf zwei Wegen gelangte sie nach Mitteleuropa: Im Jahr 1555 brachte ein gewisser Ghislain de Busbecq, seines Zeichens Gesandter des Habsburger Kaisers Ferdinand I., Tulpensamen als Geschenk des Sultans Soleiman des Prächtigen aus Konstantinopel nach Wien an den Hof. Wenige Jahre später gelangten erste Zwiebeln auch auf Handelswegen über Venedig nach Augsburg in die Fuggerschen Gärten. Dort hatte sie auch der Schweizer Botaniker Conrad Gessner (1516–1565) zum ersten Mal erblickt und – hingerissen von ihrer orientalischen Pracht – sie sogleich in sein botanisches Standardwerk aufgenommen.

Saladin, Sultan von Ägypten und Syrien «Semper Augustus», die Tulpe aller Tulpen †
(Cristofano dell’Altissimo, um 1566/68) (aus einem Pflanzenbuch, 17. Jh.)
An ihre eigentliche Herkunft erinnert noch heute ihr Name. Sie verdankt ihn ihrer charakteristischen Form, die dem raffiniert geschlungenen Kopfputz türkischer Herrscher gleicht. Tülbend ist das türkische Wort für Turban, denn offensichtlich gibt es da nicht nur die optische, sondern auch eine sprachliche und botanische Verwandtschaft zur Türkenbundlilie, die, wie die Tulpe, ebenfalls zur Familie der Liliengewächse, der Liliaceae gehört.
1593 verliess der flämische Hofbotaniker Charles d’Ecluse – Carolus Clusius, wie er sich dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend in gelehrtem Latein nannte – den Wiener Hof, um sich im holländischen Leiden niederzulassen. In seinem Gepäck befand sich ein Säcklein Tulipanenzwiebeln, mit denen der emeritierte Professor seinen Lebensabend zu vergolden dachte. In der Tat bekam der kalkhaltige und durchlässige Leidener Sandboden den unscheinbaren «Bollen» vorzüglich. Die Kunde von der neuen Blume verbreitete sich in Windeseile und animierte gar einen dreisten Dieb, die kostbaren Zwiebeln aus den professoralen Rabatten bei Nacht und Nebel auszubuddeln. Das unrechte Gut strafte das Sprichwort und die Moral Lügen: Es gedieh prächtig, und im folgenden Frühling sprossen Tulpen zum Ärger des Professors auch in anderen Gärten

Als besonders wertvoll galten natürlich schon bald die mutierten Sorten, also jene, die durch eine Laune der Natur, einen Virus oder gar einen Schädling ihr Aussehen verändert hatten und die Züchter mit gestreiften, gekrausten, zweifarbigen Blütenblättern überraschten. Mit der Zeit entstanden neue Varietäten. So konnte sich 1733 ein adliger Hobbygärtner mit über 2000 Sorten in seinem Garten brüsten, und 1948 zählte die Allgemeine Niederländische Blumenzüchter-Vereinigung 3800 registrierte Sorten. Der Wunsch nach immer neuen Farbstellungen und Blattformen scheint unstillbar zu sein. Immerhin umfasst das heutige Handelssortiment etwa 300 Sorten. Da ist zum Beispiel die orange-violett geflammte Irene. Oder die gelbe Mickey Mouse mit den frechen roten Streifen. Die gefüllte Angélique, deren zartes Rosa wie Porzellan wirkt und die im offenen Zustand fast wie eine Rose (also doch!) aussieht. Dann gibt es die signalrote Rokoko mit den neckisch gefransten Blütenblättern, auch Papageientulpe genannt. Die weisse Snow Star. Aladin, die spitzblättrige. Und schließlich «de zwarte tulp» mit Namen Arabian Mystery, der blauschwarze Traum aller Züchter – und auch des Dichters Charles Baudelaire, der dieser «fleur incomparable» in seinen «Petits poèmes en prose» von 1868 huldigt: «Moi, j’ai trouvé ma tulipe noire...» Und er meint dies natürlich keineswegs ausschließlich botanisch!


Individualist, Querschläger, Laune der Natur?
In der Natur entstehen neue Varietäten durch zufällige oder bewusst vom Züchter vorgenommene Kreuzung. Dabei werden die Pollen der einen Sorte auf den Stempel der Blüten einer anderen Sorte gebracht. Die auf diese Weise heranreifenden Samen ergeben eine neue dritte Sorte. Allerdings ist das Resultat nicht exakt voraussehbar, und es dauert gut und gern 15 Jahre, bis eine neue Sorte auf den Markt kommt. Eine andere invasivere, heute noch teure und aufwändige Methode ist es, die Tulpenzwiebeln zu bestrahlen, um dadurch ihre Erbanlagen zu mutieren.

Die Tulpenblase
Bereits um 1600 wurden die Zwiebeln der Wunderblume aus dem Morgenland mit Gold aufgewogen. Bollenraserey, Tulpomania, Zwiebelwahn, nannte man das Tulpenfieber, das zwischen 1634 und 1637 ganz Holland in einen wahren Spekulationstaumel versetzte. Abgelegene Landkneipen mutierten zu dubiosen Tausch- und Handelsplätzen. Ochsen, Schiffe, Getreide, Hausrat, Ölgemälde wurden für den Besitz der unansehnlichen Bollen eingesetzt. Die Preise erreichten bald astronomische Höhen. So soll Anfang des 17. Jahrhunderts eine einzige Zwiebel der Sorte «Admiraal van Enkhuijzen» für 11 500 Gulden die Hand gewechselt haben. Für drei Knollen der «Semper Augustus» blätterte 1636 ein Liebhaber die horrende Summe von 30 000 Gulden hin. Zum Vergleich: Ein Amsterdamer Grachtenhaus kostete damals ungefähr ein Drittel dieser Summe.

Korb mit Blumenzwiebeln – Hyazinthen? (Vincent van Gogh, 1887)
Es wurde aber nicht nur mit den eigentlichen Zwiebeln gehandelt, sondern auch mit Anteilscheinen davon. Die Chroniken berichten von Reichen, die in Kutschen vorfuhren, um wenig später zu Fuss, aber mit ein paar Zwiebeln oder Anteilscheinen in der Tasche die Spelunke wieder zu verlassen. Doch auf einmal stiegen die Preise nicht mehr. Viele hatten plötzlich den Drang, ihre virtuellen Blumen so schnell wie möglich in reales Geld zurückzuverwandeln. Am 5. Februar 1637 – es soll ein Dienstag gewesen sein! – brach das Ganze wie ein Kartenhaus zusammen: Eine Versteigerung in Haarlem markierte den Anfang vom Ende. Die Käufer blieben aus, die Preise sackten ins Bodenlose. Spekulanten, die nach dem Buchwert ihrer Tulpen märchenhaft reich gewesen waren, verloren ihr gesamtes Geld. Hunderte von Züchtern, Händlern und Hasardeuren gingen bankrott. Tausende längst geschlossene Kaufverträge konnten mangels Kapitals nicht mehr vollzogen werden und wurden für eine Strafgebühr von wenigen Prozenten der vereinbarten Summe annulliert. Die holländische Regierung griff ein – zu spät: Am 27. April desselben Jahres erließ sie ein Dekret, dass Tulpen Waren und kein Investment seien. Sie setzte Preise fest und verbot den Banken, Tulpenzwiebeln als Sicherheiten für Kredite zu akzeptieren. Ferner mussten Tulpenzwiebeln im Handel ab sofort bar bezahlt werden. Damit war dem Handel mit den Anteilscheinen und der Verkauf der Zwiebeln ein Ende gesetzt ...
Schon damals nahmen zeitgenössische Maler wie Hendrick Gerritsz Pot diesen Irrsinn aufs Korn. Auf einem Gemälde lässt er die Göttin Flora samt närrischem Gefolge auf einem Karnevalswagen mit geblähten Segeln dem Untergang im Meer entgegenschlittern. Oder Jan Brueghel der Jüngerer, der Banden von Affen um ein paar Zwiebeln feilschen und lärmen lässt.


1935, also rund dreihundert Jahre später, schob der FAZ-Journalist und Schriftsteller Otto Rombach eine hübsche Geschichte zu jenem tollen Jahr 1637 nach. In seinem Schelmenroman «Adrian, der Tulpendieb» (1935) stiehlt ein einfacher Torfknecht nachts aus dem Garten seines Brotherrn drei Tulpenzwiebeln und ersetzt diese durch normale Gemüsezwiebeln. Mit seiner Beute steigt er in den Handel ein und erwirbt sich mit List und Tücke bald ein phantastisches Vermögen. Als Tulpenbaron wirbt er um Christintjes Hand, die jedoch für den forschen Kapitän Josias schwärmt. Und diesem – Liebe geht durch den Magen – ein Heringsmahl mit Zwiebelringen vorsetzt. Fatalerweise hatte sie Adrians «Semper Augustus» für eine ordinäre Speisezwiebel gehalten... Der Stoff wurde als erste sechsteilige Fernsehserie in Farbe aufgenommen und im Versuchsprogramm für das deutsche Farbfernsehen 1966 ausgestrahlt.
Inzwischen hat sich die Tulpe von der exklusiven Luxusblume zum Massenprodukt gewandelt. Und da ich sie nicht mehr abmalen muss, hat sich auch mein Verhältnis zu ihr radikal geändert: Sie verkündet mir unmissverständlich den kommenden Frühling, selbst an Tagen, an denen dessen viel zitiertes blaues Band noch klamm und schlaff im kahlen Gezweig hängt, statt blau und ahnungsvoll durch die Lüfte zu flattern.

Tulpenbilder: Bruno Rauch
Wenn Sie Blumen mögen, könnten Sie vielleicht auch folgende Beiträge interessieren:
– Amimositäten (über Mimosen)
– Rosen ohne Dornen (über Pfingstrosen)
Weitere Beiträge finden Sie hier.
Abonnieren Sie die «rauchszeichen» – gratis und franko und ohne jede Verpflichtung!
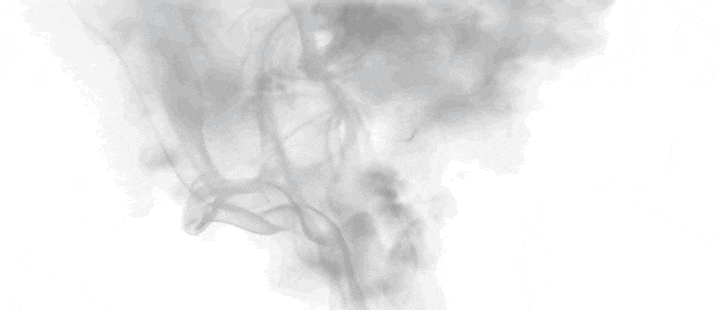


Danke! Hochspannend dein Beitrag. Und hier noch ein Roman; handelt im 17.Jahrhundert (1636), im Umfeld des von dir beschriebenen Tulpenfiebers, natürlich in Verbindung mit einer Liebesgeschichte. (Suhrkamp/Insel Verlag ISBN 978-3-458-36170-1)
Herzlichen Dank auch für diesen „kulturellen“ Beitrag, den ich mir eben als vergnüglich-entspannende Feierabendlektüre zu Gemüte geführt habe.
F. G.
Ein sehr schöner und interessanter Beitrag! Leider sind die heutigen Tulpen meist so "programmiert", dass sie nur einmal zuverlässig blühen, sodass der Tulpenliebhaber jedes Jahr neue Zwiebeln kaufen muss, will er sich weiterhin an der Blütenpracht erfreuen. So haben sich die holländischen Züchter ein kommerzielles Perpetuum mobile geschaffen. Das ist der Grund, dass wir mittlerweile auf Tulpen im Garten weitgehend verzichten, ist doch das Setzen der Zwiebeln im späten Herbst ein mühsames Geschäft.
Grüezi Herr Dr Rauch
Nicht nur Musikgeschichten erscheinen aus Ihrer "Feder", nein, auch spannende Blumengeschichten, interessant und ein wahres Vergnügen! Ich freue mich auf weitere Lese-Erlebnisse.
Liebe Grüsse
Norbert Nussbaumer