Liebe, Suff und Musenkuss
- Bruno Rauch

- 7. Juli 2025
- 8 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 15. Okt. 2025

«Glou! Glou! Glou!» – schallt’s von der schwarzen, leeren Bühne des Zürcher Opernhauses, in deren Mitte einsam ein großes Fass thront. «Glou! Glou! Je suis la bière - je suis le vin.» Der Alkohol besingt sich gleich selbst: Bier- und Weingeister preisen den Gersten- und Rebensaft als probates Mittel gegen menschliche Schwermut – natürlich unsichtbar, wie es nun mal dem Wesen der Geister entspricht.
Und es passt! – Nicht nur als szenische Idee, sondern auch als Sinnbild für die Umstände unter denen Regisseur Andreas Homoki und sein Team diese Produktion von Offenbachs Opéra fantastique «Les contes d’Hoffmann» – realisierten. Nämlich unter den widrigen Bedingungen der Pandemie. Als Masken, Tests, Quarantäne, Schutzkonzepte den Probenalltag prägten. Als Chor und Orchester, fern der Bühne, via Glasfaser zugespielt wurden. Als die Sänger nur in kleinen Teams proben konnten. Als die Theater geschlossen waren... Und deshalb die Premiere am 11. April 2021 vor leerem Haus stattfand und anschließend nur per Stream zu erleben war: Oper trotz allem! Bewegend trotz allem! Und jetzt live – der Eindruck von damals bestätigt sich: Dieser Zürcher «Hoffmann» ist packend, präzise und poetisch – ein Triumph wider alle Widrigkeiten.


Schwierige Realisation – damals wie heute
Ironischerweise ist auch Offenbachs Werk selbst das Kind einer Krise, ausgelöst durch Theaterpleiten, Intendantenwechsel und Sonderwünsche. Denn es war gelungen, das Werk an zwei Bühnen zu vermitteln: Für Wien wurden durchkomponierte Rezitative verlangt, für Paris – im Sinne der Opéra comique – gesprochene Dialoge. Auch Besetzungsfragen wurden heftig diskutiert: Aus dem ursprünglich baritonalen Hoffmann wurde ein Tenor, die lyrische Sopranpartie der drei Frauenrollen mutierte zum Koloratursopran. Offenbach arbeitete wie ein Besessener, doch sollte er die Uraufführung am 10. Februar 1881 an der Pariser Opéra-comique nicht mehr erleben. Er starb drei Monate zuvor über der noch nicht vollendeten Partitur...

Der offene Charakter hat die «Contes» zu einem der wandelbarsten Werke des Repertoires gemacht – offen für Rekonstruktionen, Deutungen, Versionen. So wurde schon für die Pariser Erstaufführung der Giulietta-Akt ganz gestrichen. In Wien, wo man sich die Zweitaufführung gesichert hatte, wurde er zwar gespielt, allerdings massiv angereichert mit Fremdmaterial (teils aus Offenbachs Feder) und in die Mitte des Werks verlegt. Um das Maß der Unbill vollzumachen, brannte 1881 auch noch das Ringtheater ab – als hätte der teuflische Lindorf selbst seine Hand im Spiel gehabt..
.
Noch in den 1990er Jahren wurde neues Materials entdeckt, eingefügt, verworfen – bis heute erarbeitet sich jedes Theater seine eigene Bühnenfassung. Ganz im Sinne des Theaterpraktiker Offenbach, der bis zuletzt an seinem Werk feilte, um es pragmatisch den aktuellen Erfordernissen anzupassen.

Der Komponist: Jacques Offenbach Der Librettist: Jules Barbier Der Dichter; E.T. A. Hoffmann
(1819–1880) (1825–1901) (1776–1822) (© wc)
Dem Stoff war Offenbach bereits 1851 in einem Theaterstück von Jules Barbier und Michel Carré begegnet, das auf diverse Erzählungen E. T. A. Hoffmanns zurückgeht, dessen romantisch-gespenstische Geschichten im Paris der Zeit en vogue waren. Als versierte Theaterautoren brachten die beiden erstmals die literarische Technik einer Rahmenhandlung auf die Bühne, wie wir sie beispielsweise aus Boccaccios «Decamerone» kennen oder eben aus Hoffmanns vierbändiger Sammlung seiner Erzählungen mit dem Titel «Die Serapions-Brüder» (1819–1821).



Drei Frauenbilder – eine Projektion
Puppe, Muse, Circe – ein Stern und ein Teufel
Den literarischen Rahmen bilden zwei Akte – oft als Prolog und Epilog bezeichnet. Beide spielen in Luthers Schenke (gemeint sein könnte das noch heute existierende Lokal Lutter & Wegner am Gendarmenmarkt zu Berlin, die Stammkneipe des echten Hoffmann – wo er auch sicherlich schon mal eins über den Durst trank). Unweit davon liegt das Opernhaus, wo man soeben Mozarts «Don Giovanni» gibt – eine Lieblingsoper des historischen Hoffmann. In den Theaterpausen, beim Warten auf die Operndiva Stella alias Donna Anna berichtet der Dichter seinen Zechkumpanen von drei gescheiterten Liebesaffären. Als die vererehrte Sängerin schließlich erscheint, ist er stockbetrunken und brüskiert sie durch sein Benehmen.

Das Besondere: Hoffmann erzählt nicht bloß retrospektiv, er tritt gleichzeitig handelnd in Erscheinung – als Teil der Erzählung durchlebt und durchleidet er die schmählichen Liebschaften erneut: Illusion und Desillusionierung mit dem mechanischen «Sing-Roboter» Olympia. Zwiespalt zwischen Kunst und Liebe bis hin zur Selbstzerstörung mit der todkranken Sängerin Antonia. Verführung, Leidenschaft und Identitätsverlust im Bann der venezianischen Kurtisane Giulietta; drei – typisch männliche! – Frauenprojektionen, die sich in der Gestalt Stellas als vierter Inkarnation der Weiblichkeit verdichten. Deren Gunst wird ihm jedoch vom hinterhältigen Lindorf streitig gemacht – jenem mephistophelischen Gegenspieler, der in allen drei Episoden als rätselhafte, zerstörerische Macht auftaucht und in dreifacher Gestalt in Hoffmanns Amouren hineinfunkt.



In Zürich hat man die coronabedingte Zwangspause genutzt, um klug und differenziert zu arbeiten. Die Produktion ist tiefgründig, aber nie prätentiös; verspielt, aber nicht banal. Die brillante, funkensprühende, extravertierte Oberfläche des Werks bleibt gewahrt; überspannte Philosophistereien und gewagte Deutungsansätze werden vermieden. Wohltuend schlank und alert präsentiert sich Offenbachs Meisterwerk, witzig, pfiffig, sarkastisch, bissig... Wo’s nottut, auch überschwänglich und mit einem wohldosierten Schuss Sentimentalität. Auf allzu feuchtfröhlichen Dunst, auf dämonisierenden Ausstattungszauber oder erotisch überhitzten Schwulst – etwa im Venedig-Akt (ohne Gondeln!) – wird verzichtet. Stattdessen lebt der Abend vom intelligenten Erzählen, von Esprit, umsichtiger Personenführung und hoher Musikalität. Was die raffinierte Faktur des Librettos zwischen Realität und Fiktion, zwischen Traum und Wahn umso deutlicher zu Tage treten lässt und so die kontrastreichen, divergierenden Einzelszenen meisterlich zur Einheit zusammenbaut.


Gleiches gilt auch für die Musik, die sich aus unterschiedlichsten Quellen speist, was dem Komponisten erlaubt, verschiedene Stile, Formen und Genres geistreich zu verknüpfen und so inneren Gehalt und äusserlichen Effekt mit genialischer Leichtigkeit und Originalität in Einklang zu bringen. Das Orchester der Oper Zürich, das zum Glück bald wieder so heißen darf, unter Stabführung vom Antonino Fogliani wird dieser durch und durch französischen Musik in hohem Maße gerecht: Luftig, durchsichtig und federnd klingen die Streicher, sinnlich schwelgt das Cello, exquisite Klangfarben zaubern die Bläser... die prickelnde Offenbachiade findet genauso ihren Ausdruck wie das leidenschaftliche Pathos der Grand Opéra.

Die Ambivalenz der oszillierenden Ebenen spiegelt sich in dem in seiner Einfachheit faszinierenden Bühnenbild von Wolfgang Gussmann. Die Rückwand der beschriebenen schwarzen Bühne für das Vor- und Nachspiel öffnet sich jeweils für die drei Binnen-Akte auf ingeniöse Weise, indem sich wie in einer Lanterna magica eine rautenförmige linsenartige Öffnung – man könnte auch von einer Blende sprechen – auftut. Diese gibt den Blick frei auf die diversen Schauplätze, die mit leichter Veränderung doch immer dieselben sind: Offenbachs Introspektion nämlich.


Wir sehen da eine ebenfalls rautenförmige, schiefe Spielfläche, die frei zu schweben scheint und sich in alle Richtungen neigen kann. Zudem ist dieses instabile Spielfeld mit einem Muster von schwarzen, grauen und weißen Rhomben versehen (im Fachjargon als Rhombille-Fliesen bezeichnet), die im Auge des Betrachters umkippen, changieren, sich neigen, dreidimensional wirken (M. C. Escher lässt grüßen): Das ist nicht nur äußerst dekorativ, sondern darüber hinaus eine subtile Umsetzung der irrealen Situationen bzw. des labilen Seelenzustands des Protagonisten: Imagination ins Optische übertragen!
Einzelne, gekonnt eingesetzte Elemente deuten die jeweilige Lokalität an: Ein stattliches Kanapee im Kabinett, wo der Physiker Spalanzani und der Optiker Coppelius (er liefert die Augen des singenden Automaten) ihre Spinnereien betreiben. Dann ein bezauberndes Setting, geradezu an ein niederländisches Gemälde erinnernd, wo, verführt vom diabolischen Dr. Miracle, Antonia in vermeerschem Blau am Pianoforte singend ihre Seele aushaucht. Und schließlich ein pompöser Lüster für den Palazzo am Canal Grande, wo der Zuhälter Dappertutto die Kurtisane Giulietta instrumentalisiert, um ihren Freiern Spiegelbild und Schatten abzuluchsen.

In diesen Vignetten bilden die Kostüme – Bratenrock und Tournüre erinnern vage an die Eleganz des ausgehenden 19. Jahrhunderts – mit ihrer intensiven Farbigkeit und textilen Opulenz einen reizvollen Blickfang: Süßes Pink für Olympias Rüschenrobe, erotisches Karminrot für Giulietta und eben sattes Blau für die hingebungsvolle Antonia. Teils witzig schräg, teils überkandidelt sind die Comprimarii – Zecher, Lakaien, Volk, Studenten (natürlich mit Käppi und Couleurband) – kostümiert. (Wolfgang Gussmann und Susana Mendoza).

Jetzt aber höchste Zeit, dass die Muse dem Fass entsteigt, sich alsbald ihres dichterischen Lorbeerkranzes entledigt und zu Niklausse wird, Offenbachs Kumpel, Mahner und Schutzgeist. Marina Viotti mit warm leuchtendem Mezzosopran trifft exakt den Ton zwischen kühler Distanz, liebevoller Ironie und engagierter Fürsorge.


Der Sänger des Lindorf übernimmt – richtigerweise – den Part der drei Bösewichte (Coppélius, Miracle, Dappertutto), die letztlich die multiple Ausformung ein und derselben dunklen Macht darstellen. Andrew Foster-Williams verleiht den düsteren Gesellen mit Zylinder, Mantel und Schultercape in wechselnden Farben eindrückliche Gestalt. Dabei setzt er nicht auf auftrumpfende Stimmpower, sondern auf eher verhaltene Dämonie und tückischen Sarkasmus, was unheimlicher und beängstigender wirkt, zumal er seinen Gehstock wie einen Zauberstab einsetzt. Durchs Band weg überzeugend sind auch die weiteren Rollen besetzt, etwa Daniel Norman als Tüftler Spalanzani oder Judith Schmid als Antonias verstorbene Mutter, um nur zwei herauszugreifen.

Für die drei Geliebten Hoffmanns hat man sich – entgegen der Tradition der Besetzung mit einer einzigen Sängerin, was inhaltlich zwar korrekt, stimmlich aber oft unbefriedigend ist – für eine Aufteilung auf drei Soprane von unterschiedlichem Charakter entschieden.
Drei Frauen – eine Projektion
Echt offenbachscher bzw. hoffmannscher Geist – das Wort Esprit wäre treffender – animiert den ergötzlich-schauerlichen Avatar Olympia. Katrina Galkas Koloratursopran scheint keine Grenzen zu kennen. Mühelos und oft noch eine Spur exaltierter, als es die Partitur vorgibt, zwitschert und tiriliert sie sich durch die abenteuerliche Stimmakrobatik und setzt da und dort vokale Dolchspitzen, die befürchten lassen, der Kronleuchter im Saal möge zerspringen. Ihr komödiantisches Talent und ihre körperliche Beweglichkeit machen diese Olympia zur virtuos überdrehten Parodie auf sinnentleerte Bravour – aus heutiger Sicht vielleicht gar ein Seitenhieb gegen die Mechanismen der digitalen Verführung? Jedenfalls bedauert man es fast, dass Offenbach seine magische Brille absetzt und so das singende Räderwerk zum Stillstand bringt.

Herzensergießung und Lyrik prägen dagegen den Antonia-Akt. Adriana Gonzalez verkörpert die schwindsüchtige Künstlerin mit einer Mischung aus Fragilität und Gefühlsüberschwang, hingebungsvoller Anmut und fiebriger Ekstase. Und wenn sie in einer letzten Koloratur entseelt zu Boden sinkt und von dem auf der schiefen Ebene bedrohlich ins Rutschen geratenen Flügel fast erschlagen wird, stockt einem der Atem.
Intensität im Ausdruck, Noblesse in der Erscheinung zeichnen die Kurtisane Giulietta aus. Lauren Fagan gestaltet die zwielichtige Figur mit Grandezza und lässt zwischen der Professionalität als femme fatale, und professionelle Verführerin einen Hauch von Melancholie, ja, sogar von Sympathie für das Opfer Hoffmann erahnen. Rätselhaft, undurchdringlich – eine weitere Folie männlicher Projektion... Und ein weiteres Beispiel für Homokis Regiehandschrift, die im Wesen der Handelnden stets das Mehrdeutige, Vielschichtige sucht.


So gilt denn sein besonderes Augenmerk auch der oft vernachlässigten Rolle der Operndiva Stella, dargestellt von Maria Stella Maurizi. Statt am Schluss dem nach Liebe gierenden Lindorf zu folgen, verpasst sie ihm eine Ohrfeige und zerbricht seinen magischen Gehstock... Eine Frau, die sich souverän aus der Rolle als Projektionsfigur befreit.


Ein idealer Hoffmann
Ob ihr Hoffmann – stockbetrunken und in Wahnvorstellungen verstrickt – ein ebenbürtiger Partner auf Augenhöhe sein könnte...? Für die stimmlich wie darstellerisch überaus anspruchsvolle Rolle ist Saimir Pirgu eine Idealbesetzung. Mit seinem kraftvollen, zugleich lyrischen Tenor schlägt er mühelos den Bogen vom taumelnden Träumer zum tragischen Helden. Er identifiziert sich schrankenlos mit der schillernden Figur des Dichters, aufgerieben zwischen Kunst und Liebe. Die emotionalen Exzesse nimmt man ihm ebenso ab wie den im Rausch ertränkten Zynismus oder die resignierende Verzweiflung. Auch die groteske Lust an der Begegnung mit der singenden Puppe oder den freundschaftlich-bärbeißigen Disput mit seinem Alter Ego in Gestalt von Muse/Nicklausse gestaltet er mit charmantem Feinschliff.
Und es ist eine versöhnliche, berührende Idee, dass Stella nach ihrem fulminanten Abgang für das apotheotische «On est grand par l’anour et plus grand par les pleurs» nochmals zurückkehrt – hors livret, sozusagen –, um Hoffmann nach kurzem Zögern die Hand zu reichen und ihn mitzunehmen... «On est plus grand par l’amour» – vielleicht doch...? Jedenfalls hat der zynische Lindorf das Nachsehen.

Eine mit Augenzwinkern und Ironie, mit Klangmagie und großen Gefühlen gewürzte Produktion. Offenbach hätte sie geliebt. Und Hoffmann gewiss auch.


Szenenbilder: © OHZ – Toni Suter und Monika Rittershaus
05.07.2025
Oper für alle – Am Samstag, 12. Juli, werden «Les contes d’Hoffmann»
live aus dem Opernhaus auf den Sechseläutenplatz übertragen.
Weitere Beiträge finden Sie hier.
Abonnieren Sie die «rauchszeichen» – gratis und franko und ohne jede Verpflichtung!
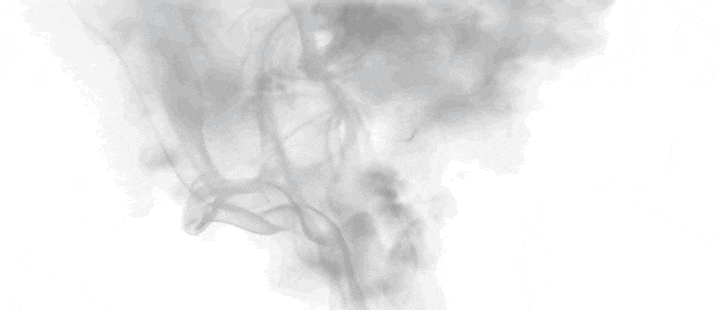


Grazie di questo bellissimo articolo e delle belle parole. Ci vediamo l’anno prossimo per la Damnation de Faust.
S. P.
Wir haben soeben das Streaming verfolgt und sind begeistert. Begeistert auch von Ihrerm stimmigen, informativen Bericht, der manches erhellt, verdeutlicht und klärt. Vielen Dank.
M. S.
Eine tolle Rezension, fast als ob man dabei wäre. Danke sehr! Vielleicht schaffen wir das Public Viewing.
K. M.